Chancen und Innovationen auf See – Hybride Interkonnektoren und hybride Anbindung von Offshore-Windparks stellen den Bausektor vor neue Herausforderungen.
Die künftige Bundesregierung bekennt sich einleitend zu den deutschen und europäischen Klimazielen, betont dabei aber ebenfalls, dass Klimaschutz, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und soziale Ausgewogenheit bei der Erreichung dieser Ziele gleichermaßen berücksichtigt werden sollten. Hierzu seien Innovationen sowie eine gewisse Risikobereitschaft notwendig. Hybride Offshore-Netzanschlüsse bzw. Interkonnektoren sowie die hybride Anbindung von Windparks an Kabel- und H2-Pipelines sind Innovationen, deren Ausbau die neue Bundesregierung mit Hilfe von miteinander kooperierenden Nordseeanrainern fördern will.
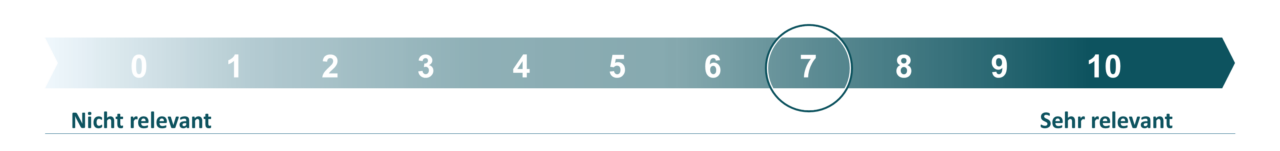
Hybride Interkonnektoren: Investitionsrisiko und Chance
Die Idee hybrider Netzanschlüsse bzw. Interkonnektoren ist nicht neu. Bereits 2023 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit den Übertragungsnetzbetreibern 50Hertz, Amprion und TenneT Pläne zur Vernetzung von Offshore-Windparks in der Nordsee veröffentlicht. Danach sollen Anbindungsleitungen von Offshore-Windparks miteinander vernetzt werden und neben der Anbindung an das deutsche Stromnetz auch den Stromaustausch mit Nachbarländern ermöglichen. Primär soll dadurch die europäische Versorgungssicherheit mit Strom verstärkt werden und die Stromleitungen besser ausgelastet und effizienter genutzt werden. Ein wirtschaftlicher Vorteil liegt insbesondere darin, dass durch die Möglichkeit des Stromaustauschs weniger nachgefragte Windparks am deutschen Markt abgeregelt also mit reduzierter Leistung betrieben oder gar ganz abgeschaltet werden können.
Auch auf EU-Ebene sind hybride Interkonnektoren fester Bestandteil zur Erreichung der gemeinschaftlichen Klimaziele. Bis 2030 soll die grenzüberschreitende Stromerzeugungskapazität sowohl durch Onshore- als auch durch Offshore-Projekte verdoppelt werden. Bis 2050 werden für den Ausbau von Offshore-Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien schätzungsweise EUR 400.000.000,00 benötigt. Diese Investitionen aus öffentlicher und privater Hand dauerhaft zur Verfügung zu stellen, ist eine besondere Herausforderung. Vorhabenträger müssen hier in besonderem Maße Kosten und Nutzen abwägen.
Mögliche Herausforderungen für Hersteller, Lieferanten und EPC-Kontraktoren
Spezialisierte (Bau-)Unternehmen bieten die notwendigen Leistungen am Markt für den Ausbau der Offshore-Windpark-Kapazitäten oftmals als Konsortium verbunden an. Regelmäßig erbringt ein Auftragnehmer (ggf. als Konsortium) die Herstellung der Offshore-Plattformen selbst, ein anderer die Herstellung und Verlegung der Kabel. Aufgrund eng getakteter Meilenstein-Terminpläne, die im Angesicht der hohen Ziele im Bereich des Offshore-Windpark-Ausbaus nicht anders zu erwarten sind, stellen sich hier besondere Herausforderungen, eine präzise Terminplanung und Terminplanbewirtschaftung durch die ausführenden Unternehmen sowie ein akkurates Baumanagement zu gewährleisten. Vertragsstrafen wegen der Nichteinhaltung von Meilensteinen oder des Endfertigstellungstermins können Auftragnehmer empfindlich treffen. Andersherum sind die Auftragnehmer angehalten, etwaige Behinderungen durch die Auftraggeber detailliert zu dokumentieren, um beispielsweise behaupteten Vertragsstrafenansprüche der Auftraggeber mit einer validen Begründung begegnen zu können.
Ermöglichen der hybriden Anbindung von Windparks
Daneben möchte die künftige Bundesregierung im Windenergie-auf-See-Gesetz („WindSeeG″) die hybride Anbindung von Windparks an Kabel- und H2-Pipelines ermöglichen.
Dabei sollen der Ausbau der Windenergieanlagen auf See, die an das Netz angeschlossen werden, und der Ausbau der für die Übertragung des erzeugten Stroms erforderlichen Offshore-Anbindungsleitungen synchronisiert werden.
Bisher formuliert das WindSeeG als Ziel des Gesetzes (§ 2 Abs. 2 Satz1),
die installierte Leistung von Windenergieanlagen auf See, die an das Netz angeschlossen werden, auf insgesamt mindestens 30 Gigawatt bis zum Jahr 2030, auf insgesamt mindestens 40 Gigawatt bis zum Jahr 2035 und auf insgesamt mindestens 70 Gigawatt bis zum Jahr 2045 zu steigern.
Das WindSeeG benennt also zur Erreichung des gesetzten Ziels „installierte Leistung von Windenergieanlagen und Netzanschluss“ mit dem vorstehenden Satz indirekt zwei Voraussetzungen, nämlich den Ausbau der Windenergieanlagen sowie der dazugehörigen Anbindungsleitungen, ohne dass eine weitere Differenzierung stattfindet. Nimmt man den Koalitionsvertrag zur Hand soll neben der „klassischen“ Anbindungsleitung durch Kabel nun auch die hybride Anbindung der Offshore-Windparks an H2-Pipelines vorangetrieben oder zumindest im WindSeeG ermöglicht werden.
Was steckt dahinter? Der Gedanke, „grüne Energie“, die aus den Windparks gewonnen wird, unmittelbar zu nutzen und damit mittels Elektrolyseurs „grünen Wasserstoff″ herzustellen und unmittelbar durch (noch zu bauende) H2-Pipelines zu transportieren, ist gut. Der Ausbau solcher H2-Pipelines dürfte aber ebenso ressourcenintensiv sein wie der derzeitige Ausbau der Offshore-Windparks.
Hier kann der Koalitionsvertrag lediglich als Andeutung oder Zukunftsbote für noch kommende Projekte verstanden werden.
Worauf sollten Sie achten?
Der Koalitionsvertrag verspricht, dass es mit Offshore-Windpark-Projekten weitergeht und erweitert den Status Quo um einige relevante Aspekte. Mit dieser Bekräftigung durch die künftige Regierung dürfte eine gewisse Sicherheit entstehen, dass sich auch zukünftig Investitionen in diesen Zweig der Energiebranche lohnen.
Herausforderungen bei der Umsetzung bestehen einerseits für EPC-Kontraktoren, Hersteller und Lieferanten und dazu spiegelbildlich auch für Auftraggeber und Investoren, was beispielsweise enge Terminschienen und damit zusammenhängend zugesagte Lieferbereitschaften von Strom betrifft. Insbesondere im Hinblick auf den zeitlichen Faktor stellen sich auch in derartigen Projekten die klassischen aus dem privaten Baurecht bekannten Probleme wie Baubehinderung oder Bauzeitverzögerungsansprüche und daraus resultierend Ansprüche auf Verlängerung der Ausführungszeit oder Mehrkosten. Eine professionelle Vertragsgestaltung zur Absicherung und zur gerechten Verteilung von Risiken ist gerade bei diesen komplexen Windpark-Projekten unerlässlich.
Wir behalten die Entwicklungen rund um den Koalitionsvertrag und daraus entspringende Neuerungen der Politik und der Wirtschaft für Sie im Blick!
Wir informieren Sie in unserer Blog-Serie zum Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD fortlaufend mit aktuellen Beiträgen zu diesem Thema. Sie können diese Blog-Serie über den RSS-Feed abonnieren und werden von uns über neue Beiträge informiert.
Die englischsprachige Fassung des Beitrags finden hier: Offshore wind farms: Coalition setting a course for hybrid (cms-lawnow.com).
