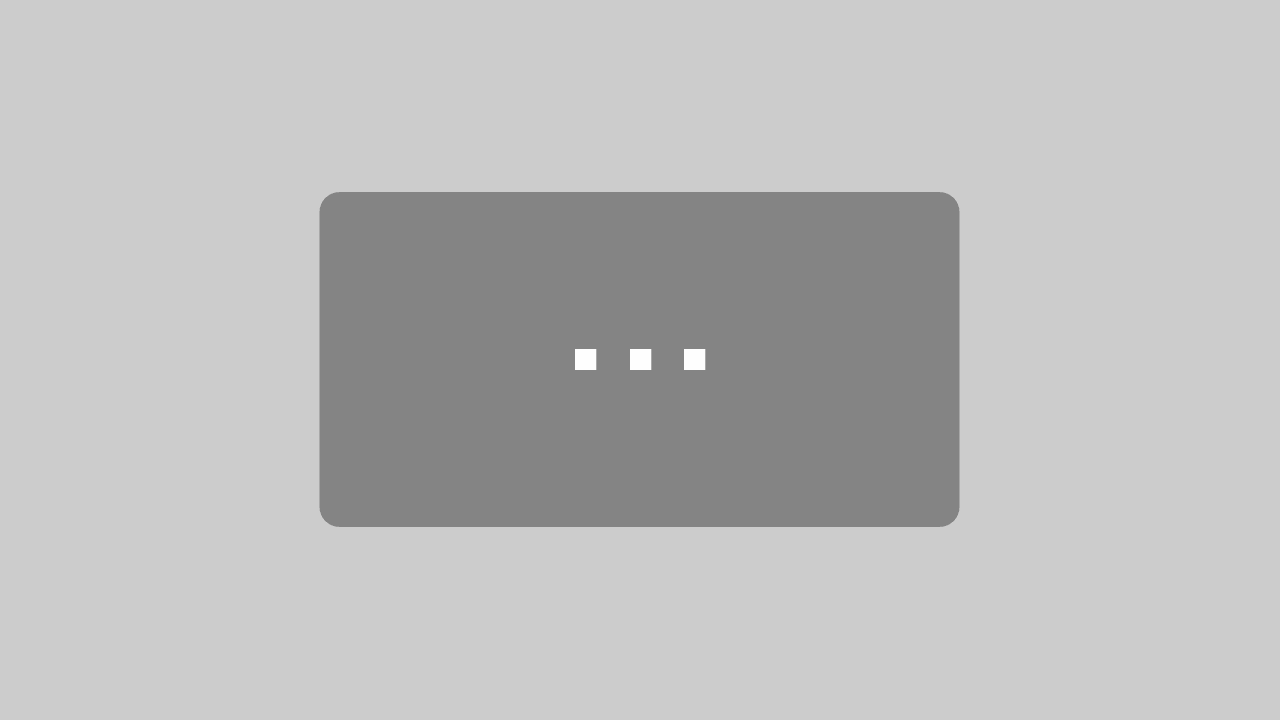Kein D&O-Schutz bei wissentlicher Pflichtverletzung – Insolvenzverwalter scheitert im Direktprozess vor dem OLG Frankfurt a. M.
Das Urteil des OLG Frankfurt a. M. vom 8. Mai 2025, Az. 3 U 113/22 reiht sich in die aktuelle Rechtsprechung ein, die zunehmend verdeutlicht, dass die organschaftliche Stellung der Geschäftsleiter* einer juristischen Person weitreichende Pflichten mit sich bringt, deren Verletzung nicht nur erhebliche persönliche Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken nach sich zieht, sondern auch den Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben kann.
Persönliche Haftung der Geschäftsleiter und D&O-Versicherung
Zentraler Maßstab für die zivilrechtliche (Innen-)Haftung des Vorstandes gegenüber der Gesellschaft ist § 93 Abs. 2 AktG (parallel hierzu regelt § 43 Abs. 2 GmbHG die entsprechende Haftung des GmbH-Geschäftsführers), der die Sorgfaltspflichten und Verantwortlichkeiten der Organmitglieder im Rahmen ihrer Geschäftsführung konkretisiert. § 93 Abs. 2 S. 2 AktG verschärft vor dem Hintergrund der besonderen Sachnähe des Vorstandes und der Vermeidung eines Beweisnotstandes aufseiten der Gesellschaft die Vorstandshaftung und normiert eine Beweislastumkehr zugunsten der Gesellschaft. Der Vorstand muss darlegen und beweisen, dass er seinen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist, ihn kein Verschulden trifft oder der Schaden auch bei pflichtgemäßem Verhalten entstanden wäre. In der wirtschaftlichen Krise der Gesellschaft (ab Einritt der Insolvenzreife) treten zudem spezielle insolvenzrechtliche Pflichten für die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen nach § 15a InsO (Pflicht zur rechtzeitigen Insolvenzantragstellung) und § 15b InsO (Haftung für verbotswidrige Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife) hinzu.
Im Rahmen dieser Haftungsrisiken kommt die Directors-and-Officers-Versicherung (D&O) zum Einsatz: Sie bietet Organmitgliedern Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen von Pflichtverletzungen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit und ist damit nicht nur ein wichtiger Bestandteil moderner Unternehmensabsicherung, sondern eröffnet auch Raum für verantwortungsvolles Handeln. Regelmäßig wird der Versicherungsschutz jedoch in den D&O-Versicherungsbedingungen ausgeschlossen, wenn das versicherte Organ seine Pflichten wissentlich verletzt. Für das Vorliegen einer wissentlichen Pflichtverletzung ist die Versicherung darlegungs- und beweisbelastet. Soweit es sich hingegen um die Verletzung einer sog. Kardinalpflicht handelt, wird zugunsten der Versicherung vermutet, dass die Pflichtverletzung wissentlich war.
Es ist allgemein anerkannt, dass das wegen pflichtwidrigen Handelns in Anspruch genommene Organmitglied seinen Freistellungsanspruch gegen die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (in der Regel an die Gesellschaft bzw. deren Insolvenzverwalter) abtreten kann (vgl. § 108 VVG). Der Freistellungsanspruch wandelt sich hierdurch in einen unmittelbaren Zahlungsanspruch des Zessionars gegen den Versicherer um, sodass dieser nicht zunächst einen Haftungsrechtsstreit gegen das Organmitglied führen muss, sondern den Haftungs- und Deckungsanspruch in einem einzigen Direktprozess gegen die D&O-Versicherung klären lassen kann.
Der Fall vor dem OLG Frankfurt a.M. (Az. 3 U 113/22)
In dem zugrunde liegenden Fall hatte der Insolvenzverwalter der X AG zwei ehemalige Vorstandsmitglieder wegen Zahlungen, die nach Insolvenzreife getätigt wurden, in Anspruch genommen. Die entsprechenden Schadensersatzklagen des Insolvenzverwalters endeten jeweils mit Vergleichsvereinbarungen, in denen sich die ehemaligen Vorstandsmitglieder gegenüber dem Insolvenzverwalter zu Teilzahlungen bereit erklärten und ihre Ansprüche aus der bestehenden D&O-Versicherung an ihn abtraten.
Das LG Frankfurt a. M. hatte die Klage des Insolvenzverwalters gegen die D&O-Versicherung am 25. März 2022 abgewiesen. Mit seinem Urteil vom 21. Juni 2023 (Az. 3 U 113/22) hatte das OLG Frankfurt a. M. die Berufung wegen der Annahme einer automatischen Beendigung des Versicherungsschutzes zurückgewiesen. Nach Aufhebung und Zurückverweisung durch den BGH (Beschluss v. 18. Dezember 2024 – Az. IV ZR 151/23) ließ der 3. Zivilsenat am 8. Mai 2025 die Klage des Insolvenzverwalters schließlich erneut scheitern, nunmehr mangels Vorliegens von abtretbaren Deckungsansprüchen der Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer wissentlichen Pflichtverletzungen.
Zentrale Aussagen des Urteils im Überblick
Das OLG Frankfurt a. M. hat in seinem Urteil zu einer Reihe interessanter Rechtsfragen im Deckungsprozess des Insolvenzverwalters als Direktprozess gegen die D&O-Versicherung Stellung genommen.
Vergleichsvereinbarungen entfalten keine Bindungswirkung
Der Senat stellt zunächst klar, dass eine im Haftungsprozess geschlossene Vergleichsvereinbarung keine Bindungswirkung für den Deckungsprozess entfaltet. Der Insolvenzverwalter habe im Einzelnen die für den Deckungsprozess entscheidenden Voraussetzungen (erneut) vorzutragen (so bereits OLG Köln, Urteil v. 9. Dezember 2003 – Az. 9 U 215/02). Eine den Haftungstatbestand betreffende Bindungswirkung des Haftpflichturteils für den nachfolgenden Deckungsrechtsstreit sei zu verneinen, da im Haftpflichtprozess gerade kein Urteil – mit bindenden Feststellungen – erfolgt sei, sondern ausschließlich Vergleiche (ohne Anerkennung einer Rechtspflicht) geschlossen wurden.
Geltung der Beweislastumkehr auch im Direktprozess
Die unstreitig im Haftpflichtprozess greifende gesetzliche Verschuldensvermutung aus § 93 Abs. 2 S. 2 AktG gilt dem OLG Frankfurt a.M. zufolge auch im Deckungsprozess als Direktprozess gegen die Versicherung mit der Folge, dass für das fehlende Verschulden der Vorstandsmitglieder die Haftpflichtversicherung darlegungs- und beweisbelastet sei. Der Senat folgt damit der Rechtsansicht des OLG Köln (Az. 9 U 206/22), das über diese – in der Literatur höchst umstrittene – Rechtsfrage bereits entschieden hatte. Für eine teleologische Reduktion der Verschuldensvermutung im Direktprozess gegen die Versicherung – wie sie teilweise mangels Informationsungleichgewicht angenommen wird – fehle es bereits an einer planwidrigen Überregulierung, da § 93 Abs. 2 S. 2 AktG auch im Deckungsprozess direkt zur Anwendung komme. Die Sachnähe der Vorstände, die der Verschuldensvermutung nach § 93 Abs. 2 S. 2 AktG zugrunde liegt, finde zudem ihre Entsprechung in dem Informationsrecht des Versicherers gegenüber den versicherten Personen (§ 31 Abs. 2 VVG), welche auch als Zeugen benannt werden können. Zudem sei die Versicherung im Direktprozess insgesamt nicht schlechter gestellt als in dem Fall, dass zunächst der Insolvenzverwalter den Haftpflichtprozess durchführt und im Anschluss das Vorstandsmitglied die Versicherung im Deckungsprozess in Anspruch nimmt. Die Versicherung wäre bei getrennter Führung der beiden Prozesse an das Ergebnis des Haftpflichtprozesses gebunden, ohne dass sie an dem Rechtsstreit beteiligt war. Demgegenüber könne sie im Direktprozess bereits auf die Haftungsfrage an sich Einfluss nehmen. Dem OLG Frankfurt a. M. zufolge führe eine teleologische Reduktion des § 93 Abs. 2 S. 2 AktG gerade im Zusammenhang mit dem Haftungsausschluss wegen wissentlicher Pflichtverletzung zu einer unangemessenen Verschiebung des versicherten Risikos zugunsten der Versicherung, die sich nach substantiiertem Vorbringen des Insolvenzverwalters zum Verschulden anschließend deutlich leichter auf einen Wissentlichkeitsausschluss berufen könne.
Zur Einordnung der Insolvenzantragspflicht/Zahlungsverbot nach Insolvenzreife als Kardinalpflicht
Der für einen Versicherungsausschluss relevante Vortrag schlüssiger Indizien für eine positive Kenntnis der Organe von den verletzten Pflichten als auch für ihr Wissen, wie sie sich pflichtgemäß hätten verhalten müssen, ist seitens der D&O-Versicherung dann entbehrlich, wenn es um die Verletzung elementarer beruflicher Kardinalpflichten geht, deren Kenntnis nach der Lebenserfahrung bei jedem Berufsangehörigen vorausgesetzt werden kann. Jedenfalls in diesen evidenten Fällen solle vom äußeren Geschehensablauf und dem Ausmaß des objektiven Pflichtverstoßes auf innere Vorgänge (wissentliches Fehlverhalten) geschlossen werden können (BGH, Urteil v. 17. Dezember 2014 – Az. IV ZR 90/13).
Das OLG Frankfurt a. M. positioniert sich ähnlich wie zuvor das OLG Köln sowie der 7. Zivilsenat des OLG Frankfurt a. M. und stellt fest, dass die Pflicht aus § 15a InsO, bei Insolvenzreife rechtzeitig Insolvenzantrag zu stellen sowie das damit im engen Zusammenhang stehende Zahlungsverbot nach Insolvenzreife aus § 92 Abs. 2 AktG a.F. (vgl. § 15b InsO n.F.), derartige Kardinalpflichten darstellen. Die Bedeutung und Wichtigkeit der Insolvenzantragspflicht gem. § 15a Abs. 1 S. 1 InsO – als wesentliche gläubigerschützende Vorschrift der Insolvenzordnung – sei für jeden Vorstand allein aufgrund der strafrechtlichen Haftung gem. § 15a Abs. 4 InsO evident. Zu den Kardinalpflichten des Vorstands gehöre daher die Vergewisserung über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft sowie die damit einhergehende Prüfung der Insolvenzreife. Offengelassen hat der 3. Zivilsenat des OLG Frankfurt a. M. jedoch, ob in „allen Fällen der jeweils schon bei leichter Fahrlässigkeit gegebenen Verletzung“ der Pflichten eine Kardinalpflichtverletzung angenommen werden kann, die zu einer Verschiebung der Beweislast zu Gunsten der D&O-Versicherung führt. Im vorliegenden Fall kam es aufgrund des Vorliegens ausreichender objektiver Umstände (für die bewusste Verletzung insolvenzrechtlicher Pflichten) auf die Annahme von Kardinalpflichtverletzungen nicht an.
Fazit und Praxishinweis
Es ist insgesamt begrüßenswert, dass die aktuelle Rechtsprechung zu bislang ungeklärten Rechtsfragen im Deckungsprozess als Direktprozess verstärkt Stellung nimmt. Das OLG Frankfurt a. M. folgt in seinem Urteil der bisherigen Rechtsprechung zur Geltung der Beweislastumkehr und stärkt zunächst die Rolle des Insolvenzverwalters im Direktprozess gegen die D&O-Versicherung. Jedoch erinnert das Urteil auch an die in den Versicherungsbedingungen regelmäßig festgelegte Gefährdung des Versicherungsschutzes aufgrund wissentlicher Pflichtverletzung des Organmitglieds. Ein Insolvenzverwalter befindet sich somit in einem nicht zu unterschätzenden Spagat zwischen Anspruchsdurchsetzung und Absicherung, da eine allzu scharfe Darstellung von Pflichtverletzungen der Geschäftsleiter den Versicherungsschutz gefährden kann.
Zweifellos sollten Geschäftsleiter frühzeitig größte Sorgfalt darauf legen, ihrer Verantwortung – insbesondere durch Erfüllung ihrer insolvenzrechtlichen Pflichten – gerecht zu werden. Eine regelmäßige Prüfung und Überwachung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens sowie eine ordnungsgemäße Dokumentation dieser Prüfung und darauf beruhenden Entscheidungen ist nicht nur aus insolvenzrechtlichen Haftungsgründen, sondern auch aus versicherungsrechtlichen Gründen zwingend geboten.
Einem Vorstand, der, […] blind in die Krise segelt, wird man deckungsrechtlich die Verletzung von Kardinalpflichten vorwerfen.
Das Urteil bestätigt, dass Geschäftsführungsorganen (insolvenzrechtliche) Kardinalpflichten obliegen und ein Verstoß dieser zugleich als eine den D&O-Versicherungsschutz entfallende wissentliche Pflichtverletzung gewertet werden kann. Hierbei dürfte es sich zwar um keinen Automatismus handeln. Unter welchen konkreten Voraussetzungen eine Kardinalpflichtverletzung eine wissentliche Pflichtverletzung im Sinne der Versicherungsbedingungen darstellt, ist aber weiterhin unklar. Insofern bleibt die Stellungnahme des BGH (Az. IV ZR 66/25) zum Urteil des OLG Frankfurt a. M. v. 5. März 2025 (Az. 7 U 134/23) abzuwarten.
* Gemeint sind Personen jeder Geschlechtsidentität. Um der leichteren Lesbarkeit willen wird im Beitrag die grammatikalisch männliche Form verwendet.