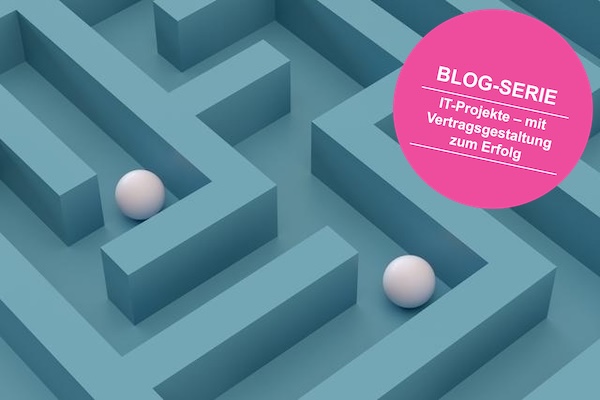IT-Projekte erfolgreich starten: Vertragstypen wie Werkvertrag, Dienstleistungsvertrag oder typengemischte Verträge richtig auswählen und gestalten.
IT-Projekte sind für Unternehmen in vielen Fällen mit großen organisatorischen und unternehmerischen Anstrengungen, aber auch Risiken verbunden. Zwischen dem Entschluss, ein neues System einzuführen, und der Entscheidung für ein bestimmtes System und einen bestimmten Anbieter vergehen oft viele Monate intensiver Planung und Prüfung. Ist endlich der richtige Anbieter mit dem richtigen Produkt gefunden, ist der Wunsch groß, schnellstmöglich mit der eigentlichen Projektarbeit zu beginnen. Die bewusste Wahl des Vertragstyps erscheint in diesem Moment als eine formaljuristische Spitzfindigkeit, die auf den Verlauf und das Ergebnis des Projekts kaum einen Einfluss haben sollte – weit gefehlt.
Die Wahl des Vertragstyps ist eine erste wichtige Weichenstellung in jedem IT-Projekt
Das deutsche Schuldrecht kennt keinen Typenzwang. Grundsätzlich können die Vertragsparteien ihre Vertragsbeziehung weitestgehend frei gestalten. Gleichwohl lassen sich auch in innovativen Branchen die meisten Leistungsbeziehungen unter die bereits gesetzlich ausgestalteten Vertragstypen wie Kauf- oder Werkvertrag fassen. Unabhängig von der Typisierung eines konkreten Vertrags ist das Grundprinzip des Vertragsrechts stets das gleiche: Eine Partei erbringt eine Leistung und erhält dafür eine Gegenleistung. In einem Projekt, das völlig reibungslos abgeschlossen wird, mag sich die Relevanz der Typisierung der geschuldeten Leistung auch tatsächlich in Grenzen halten.
Leider sind die IT-Projekte, die vollständig nach Plan und ohne Probleme ablaufen, in der Minderheit. Ein erheblicher Teil aller IT-Projekte (einige Quellen sprechen von bis zu 85%) wird erfahrungsgemäß früher oder später auf Probleme stoßen. Sobald Verzögerungen auftauchen, eine Partei mit dem Fortschritt oder Ergebnis des Projekts unzufrieden ist, oder Meinungsverschiedenheiten im Hinblick auf Verantwortlichkeiten und Details der Leistungserbringung auftreten, zeigen sich die teils erheblichen Unterschiede der verschiedenen Vertragstypen: Unter welchen Voraussetzungen lässt sich Nachbesserung verlangen oder die Vergütung mindern? Wer kann sich wann vom Vertrag lösen, und welche Folgen zieht das nach sich? Welche gesetzlichen Rechte lassen sich vertraglich einschränken? Im Rahmen der rechtlichen Handlungsoptionen ergeben sich zwischen den verschiedenen Vertragstypen erhebliche Unterschiede.
Komplexität erfordert eine bewusste Entscheidung
Viele Geschäftsvorgänge lassen sich auch ohne ausdrückliche vertragliche Festlegung ohne Weiteres einem bestimmten Vertragstyp zuordnen. Erwirbt etwa ein Unternehmen Rohstoffe zur weiteren Verarbeitung, lässt sich dieser Erwerb in aller Regel als Kaufvertrag identifizieren. Übernimmt ein Hausmeisterservice die wöchentliche Reinigung des Unternehmensgeländes, wird von einem Dienstvertrag auszugehen sein.
Mit zunehmender Komplexität der unter einem Vertrag zu erbringenden Leistungen wird eine Einordnung jedoch immer schwieriger und zunehmend von der konkreten Ausgestaltung des Vertrags abhängig. Die Wahl des Vertragstyps sollte sorgfältig abgewogen werden. Ein „one size fits all″-Ansatz verbietet sich, da auch auf den ersten Blick sehr ähnliche Projekte im Detail oft massive Abweichungen zeigen.
Um einen ersten Überblick zu verschaffen, werden im Folgenden beispielhaft einige der Weichenstellungen kurz dargestellt, die in der Praxis regelmäßig auftauchen.
Kauf oder Miete – Hauptsache verfügbar?
Die Beschaffung neuer Software erschöpfte sich bis in die frühen 2000er Jahre hinein oft im Erwerb eines dauerhaften Nutzungsrechts an einem auf physischen Datenträgern ausgelieferten Programm. Diese Software wurde sodann auf den eigenen Systemen des erwerbenden Unternehmens betrieben. Es handelte sich mithin klarerweise um eine kaufrechtliche Angelegenheit. Seither ist eine zunehmende Verlagerung hin zur lediglich zeitweisen Überlassung und zum Betrieb von Software in der Cloud – oft auf durch den Anbieter selbst oder seine Subunternehmer zur Verfügung gestellten Servern – zu beobachten. Dadurch gewinnen andere Vertragstypen, wie etwa Mietverträge, im Softwarebereich eine größere Bedeutung.
Die Abgrenzung zwischen Kauf- und Mietvertrag ist vergleichsweise eingängig: Wenn eine dauerhafte Überlassung gewünscht ist, ist ein Kaufvertrag zu wählen. Bei nur vorübergehender Überlassung steht ein Mietvertrag im Vordergrund. Neben den „klassischen Fällen″ von Softwarekauf und Softwaremiete existieren natürlich auch andere Gestaltungsmöglichkeiten: Gerade Verträge zu „Software as a Service (SaaS)″-Leistungen werden in der Praxis oft auch als Dienstverträge ausgestaltet. In diesen Fällen steht nicht die Zurverfügungstellung einer bestimmten Software per se, sondern das Erbringen einer bestimmten Leistung durch die zur Verfügung gestellte Software im Fokus.
Eine klare Definition des Projektscopes ist in jedem Fall unerlässlich. Wenn eine zeitliche Begrenzung gewünscht ist, muss sich aus dem Vertrag eindeutig ergeben, was zeitlich begrenzt ist. Auch wenn die Vertragslaufzeit begrenzt ist und die Parteien sich einig sind, dass nach Ablauf der Vertragslaufzeit der Anbieter seine Cloud nicht mehr zur Nutzung zur Verfügung stellt, muss sich dies nicht zwangsläufig auch auf das Recht zur Nutzung der Software selbst erstrecken. Der Kunde kann durchaus ein Interesse daran haben, ein dauerhaftes Nutzungsrecht an einer Software zu erwerben und die Software nach Ablauf der Vertragslaufzeit selbst oder durch einen Dritten weiter zu betreiben. In einem solchen Fall hätte die Überlassung der Software kaufrechtlichen Charakter, während die Nutzung der Cloud für den Vertragszeitraum mietvertraglichen Charakter aufweist. Ohne eine ausdrückliche Festlegung, welche Rechte in welcher Weise zeitlich begrenzt sein sollen, ist Streit jedoch vorprogrammiert.
Sowohl bei einem Kauf- als auch bei einem Mietvertrag kann der Kunde im Fall von Mängeln grundsätzlich deren Behebung verlangen, die Vergütung je nach Schwere der Mängel reduzieren oder sich von dem Vertrag lösen. Bei Ausbleiben der geschuldeten Vergütung kann sich auch der Anbieter unter bestimmten Voraussetzungen vom Vertrag lösen und sein Produkt wieder zurückverlangen. Entstehen einer Vertragspartei aus dem vertragswidrigen Verhalten der anderen Vertragspartei Schäden, steht ein Schadensersatzanspruch im Raum. Die Entscheidung, ob ein Projekt kaufvertraglich oder mietvertraglich gestaltet werden sollte, kann daher primär danach getroffen werden, ob eine dauerhafte Nutzung nach einmaliger Leistungserbringung (z.B. Download einer Software mit zeitlich unbegrenzter Lizenz) oder eine zeitlich begrenzte Nutzung mit während dieser Dauer fortgesetzter Leistungserbringung (z.B. SaaS-Leistung mit auf ein Jahr begrenzter Lizenz) gewünscht ist. Für Anbieter gilt es allerdings zu beachten, dass eine Mietsache entsprechend auch dauerhaft mangelfrei gehalten werden muss.
Kauf- oder Werkvertrag – Von der Stange oder maßgeschneidert?
Ist der Erwerb von Software geplant, ist eine klassische Weichenstellung zu treffen: Soll eine Standardsoftware angeschafft werden, oder erfordern die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens die Entwicklung einer Individualsoftware?
Beim Erwerb von Standardsoftware, also einer Software, die der Hersteller in dieser Form an diverse Kunden vertreibt, sind vor allem die wirtschaftlichen Gesichtspunkte ausschlaggebend. Etwa, ob die Software für den vorgesehenen Zweck geeignet und angemessen bepreist ist. Soll stattdessen eine Individualsoftware angeschafft werden, sind darüber hinaus weitere Punkte zu bedenken: Es sollte in diesem Fall insbesondere eine vertragliche Regelung getroffen werden, wer woran welche Nutzungsrechte erhält. Der Auftraggeber hat hier natürlich (wie bei der Standardsoftware auch) in erster Linie ein Interesse daran, dass er die für ihn entwickelte Software selbst uneingeschränkt nutzen kann. Hinzu kommt aber gegebenenfalls auch das Interesse, die Individualsoftware später auch selbst verändern oder weiterentwickeln zu können, wofür der Auftraggeber unter anderem auf den Sourcecode der Software angewiesen ist. Unter Umständen hat der Auftraggeber zudem ein Interesse daran, Dritte von der Nutzung ausschließen zu können. Schließlich soll die Konkurrenz von den Investitionen, die der Auftraggeber zur Entwicklung der Individualsoftware getätigt hat, nicht ohne weiteres profitieren können. Möchte der Auftragnehmer dennoch die für den Auftraggeber entwickelte Software in seinen allgemein verfügbaren Produktkatalog aufnehmen, ist etwa eine Partizipation des Auftraggebers an weiteren Erlösen oder eine Reduktion der Vergütung denkbar.
Nicht immer ist die vollständige Neuentwicklung einer Software erforderlich, um den individuellen Bedürfnissen des Kunden gerecht zu werden. Stattdessen kann in vielen Fällen eine Standardsoftware verwendet werden, die nur in Teilen angepasst oder weiterentwickelt werden muss. Je nach vertraglicher Konstellation ist dann entweder die reine Tätigkeit der Anpassung der Software geschuldet (Dienstvertragsrecht) oder ein konkretes Ergebnis der Anpassung (Werkvertragsrecht). Bezüglich der individuell angepassten Bestandteile ergeben sich die gleichen rechtlichen Herausforderungen, wie oben für vollständige Individualentwicklungen dargestellt.
Darüber hinaus muss ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, wer die Verantwortung für die Wahl der Standardsoftware übernimmt, die um eine Individualentwicklung erweitert werden soll: Zeigt sich etwa später, dass die Standardsoftware als Grundlage der Entwicklung ungeeignet ist, sollte klar sein, wer die initiale Einschätzung der Eignung zu vertreten hat. Wie so oft verbietet sich auch hier eine schematische Behandlung: Nicht jede Anpassung einer Standardsoftware kann ohne weiteres als Individualentwicklung eingeordnet werden. Auch die Übergänge zwischen der Vornahme von individuellen Einstellungen hin zu einer Anpassung der Software selbst können fließend sein. Beispielsweise kann ein Softwarehersteller Kundenanfragen auch zum Anlass nehmen, seine Software im Allgemeinen um diejenigen Funktionen zu erweitern, die erforderlich sind, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden, ohne dass die Kunden diese Entwicklung als Individualentwicklung beauftragt hätten. Nutzt ein Kunde später diese angepasste Software bleibt es rechtlich gesehen bei der Verwendung von Standardsoftware, selbst wenn es das Produkt ohne seine Anfrage so nie gegeben hätte.
Im Gegensatz zur Abgrenzung Kauf/Miete ist das Ziel eines Kaufvertrags und eines Werkvertrags funktionell das gleiche: Geht alles glatt, hält der Kunde am Schluss ein Produkt in den Händen, das ihm zur dauerhaften, d.h. zeitlich unbeschränkten Nutzung überlassen wurde. Treten nachträglich noch Mängel zutage, laufen die Mängelrechte des Kunden bei Kauf- bzw. Werkvertrag nahezu parallel. Große Unterschiede ergeben sich aber für den Weg hin zum Ziel: Während der Anbieter im Kaufrecht dem Kunden eine Kaufsache übereignen muss, ist diese im Werkrecht erst eigens herzustellen. Diesem Umstand trägt das Gesetz Rechnung, indem es ausdrückliche Regelungen für den Zeitraum der Herstellung des Werks bietet. Regelmäßig sind etwa Mitwirkungsleistungen durch den Kunden zu erbringen, bei deren Unterbleiben der Anbieter sich vom Vertrag lösen kann. Auch wenn im Laufe des Projekts die Fortführung bis zur Fertigstellung des Werks für eine der Vertragsparteien unzumutbar wird, können sich die Parteien durch außerordentliche Kündigung vom Vertrag lösen. Ohne dass es eines solchen wichtigen Grundes bedarf, kann sich zudem der Kunde jederzeit durch Kündigung einseitig vom Vertrag lösen, wenngleich er sich dadurch nicht vollständig seiner Vergütungspflicht entziehen kann. Apropos Vergütung: Während der Kaufpreis mit Vertragsschluss unmittelbar fällig ist, wenn nichts Abweichendes vereinbart wurde, wird die Vergütung beim Werkvertrag erst fällig mit erfolgter Abnahme des Werks als im Wesentlichen fehlerfrei – der Anbieter ist also insoweit zur Vorleistung verpflichtet. Neben reinen Sachzwängen (ist ein geeignetes Produkt überhaupt auf dem Markt zum Kauf verfügbar, oder muss es ohnehin individuell gefertigt werden?) sollten die Vertragsparteien bei ihrer Entscheidung für Kauf- oder Werkvertrag die erheblichen rechtlichen Unterschiede vor Augen haben. Das Werkvertragsrecht bietet dem Kunden in der eigentlichen Projektphase erhebliche Freiheiten.
Werk- und Dienstvertrag – Ist schon der Weg das Ziel?
Eine kritische Abgrenzung, die in IT-Projektverträgen oft nicht oder nicht ausreichend klar adressiert wird, ist die Abgrenzung zwischen Werk- und Dienstvertrag. Dabei sind die rechtlichen Unterschiede enorm: Während bei Dienstleistungen die reine Tätigkeit als solche geschuldet ist, verlangt der Werkvertrag die erfolgreiche Erreichung eines definierten Ziels. Viele IT-Projektverträge beschränken sich jedoch auf oberflächliche Beschreibungen der Projektschritte, ohne die vom Anbieter zu erbringende Leistung näher zu definieren oder eine saubere Zuordnung zu einem Vertragstyp vorzunehmen. Gerade hier sind eine genaue Beschreibung und Abgrenzung dessen, was geschuldet ist, unerlässlich.
Ein Beispiel, wie eine detaillierte Leistungsbeschreibung für die Typologisierung eines Vertrags relevant werden kann: Die Migration von Daten in ein neues System lässt sich sowohl als Dienstvertrag als auch als Werkvertrag ausgestalten. Enthält ein Vertrag lediglich die Verpflichtung, den Datenbestand aus dem System A in das System B zu kopieren, hat der Anbieter gute Argumente dafür, dass er im Sinne eines Dienstvertrags seinen vertraglichen Pflichten bereits nachgekommen ist, sobald die Daten von A nach B geflossen sind. Regelt der Vertrag hingegen, in welches Format die Daten zu überführen sind und zu welcher Verwendung die Datensätze im neuen System geeignet sein müssen, spricht dies eher für einen werkvertraglich geschuldeten Erfolg der Tätigkeit des Anbieters.
Lässt sich nach Abschluss der Migration nur ein Teil der Daten im neuen System sinnvoll verwenden, kann der Auftraggeber unter Werkvertragsrecht die Abnahme verweigern und Mängelrechte geltend machen – von der Nacherfüllung über den Rücktritt bis hin zu einem Schadensersatz. Ist die Migration hingegen als Dienstvertrag ausgestaltet, hat der Anbieter mit Vornahme aller Migrationshandlungen in aller Regel seine Verpflichtungen unter dem Vertrag erfüllt, für den Erfolg der Migration ist er nicht verantwortlich. Dem Auftraggeber bleibt in solchen Fällen regelmäßig nur die bittere Erkenntnis: „außer Spesen nichts gewesen″ – die Vergütung muss er dem Dienstleister nämlich trotzdem bezahlen. Unter dem Dienstvertragsrecht ist zudem neben dem Kunden auch der Anbieter zur anlasslosen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, während diese Möglichkeit im Werkvertragsrecht nur dem Kunden zusteht.
Typengemischte Verträge – nicht Fisch, nicht Fleisch?
IT-Projekte vereinen oftmals mehrere verschiedenartige Leistungen in einem einheitlichen Vertrag. Möchte ein Unternehmen zum Beispiel seine bisher auf eigenen Servern betriebene Buchhaltung künftig in einer Cloud-Lösung betreiben, für die der Anbieter den Nutzern im Unternehmen zudem Usersupport anbieten soll, liegt vertragstypologisch ein buntes Gemisch vor. Der Vertrag enthält typische Elemente
- des Werkvertrags (Migration der Daten in die Cloud und nach Ende der Laufzeit wieder zurück),
- des Mietvertrags (Nutzung der Cloud-Infrastruktur und Software in der Cloud für einen bestimmten Zeitraum)
- sowie des Dienstvertrags (Supportleistungen).
Welches Recht bei typengemischten Verträgen zur Anwendung kommt, lässt sich nicht schematisch beantworten und hängt im Wesentlichen vom Parteiwillen sowie der entsprechenden Vertragsgestaltung ab. Lassen sich die verschiedenen Komponenten des Vertrags klar voneinander trennen, kann für jede Komponente das jeweils passende Recht angewandt werden. Um eine klare Trennung der Vertragsbestandteile zu ermöglichen, empfiehlt es sich, sowohl die verschiedenen Leistungen detailliert zu beschreiben als auch die Vergütung separat auszuweisen.
Zudem sollten sich die Vertragsparteien Gedanken darüber machen, in welchem Abhängigkeitsverhältnis die verschiedenen Leistungsbestandteile voneinander stehen. Diesen Konstellationen sollte durch vertragliche Regelungen Rechnung getragen werden. Scheitert beispielsweise die Migration, hat der Auftraggeber in der Regel kein Interesse mehr daran, die Cloud und den Support für die restliche Vertragslaufzeit ohne echte Nutzungsmöglichkeit zur Verfügung zu haben. Eine Vertragsbeendigung im Ganzen erscheint hier zwar interessengerecht, sollte zur Sicherheit aber ausdrücklich vertraglich vorgesehen werden. Erweist sich hingegen bloß der technische Support als unbrauchbar und kann der Auftraggeber diesen auch von einem Dritten beziehen, ist unter Umständen eine isolierte Beendigung der Dienstleistungskomponente sinnvoll. Auch diese Möglichkeit sollten die Vertragsparteien im Vertrag eindeutig regeln.
Bestimmung des Vertragstyps in der Gesamtschau des Vertrags
Zur Wahl des Vertragstyps genügt eine entsprechende Benennung des Dokuments oder eine reine Absichtserklärung im Vertragstext nicht. Die Bezeichnung eines Vertrags etwa als „Werkvertrag″ allein macht den Vertrag noch lange nicht zu einem solchen. Entscheidend ist vielmehr die konkrete Ausgestaltung des Vertrags als Ganzes. Ist ein Werkvertrag gewünscht, sollte daher auch das gewünschte Ergebnis beschrieben und die Modalitäten der Abnahme (etwa Abnahmekriterien) festgelegt werden.
Um Unklarheiten zu vermeiden, ist eine umfassende und eindeutige Beschreibung der Vertragsbeziehung empfehlenswert. Der Vertragstext sollte auf die wesentlichen Eckpunkte des Projekts ausdrücklich und möglichst detailliert eingehen. Dazu gehört insbesondere eine genaue Beschreibung dessen, was der Auftragnehmer schuldet, und welche Rechte und Pflichten bestehen, falls eine Leistung nicht vertragsgemäß erbracht wird.
Mit einer bewussten Entscheidung für einen bestimmten Vertragstyp können Unternehmen festlegen, welche rechtlichen Instrumente und Handlungsoptionen ihnen zur Verfügung stehen, sollte ein IT-Projekt nicht so laufen, wie gewünscht. Außerdem besteht für beide Vertragsparteien mehr Klarheit darüber, was erwartet werden kann und was nicht. Damit können die finanziellen Risiken, die zwangsläufig mit IT-Projekten einhergehen, gezielt gesteuert werden.
Gestaltung von IT-Verträgen
Dieser Beitrag bildet den Auftakt zu unserer neuen Blog-Serie zur erfolgreichen Vertragsgestaltung bei IT-Projekten. Dabei widmen wir zentralen Aspekten eigene Blog-Beiträge zu Themen wie
- Hauptsache (un)klar, Leistungsbeschreibung – konkret und detailliert vs. high-level und flexibel
- Change Management als Erfolgsfaktor im IT-Projekt
- Die Bedeutung von Mitwirkungsleistungen in IT-Projektverträgen
- Abhängigkeiten in IT-Projekten
- Die häufigsten Fehler bei IT-Verträgen.
Sie können diese Blog-Serie über den RSS-Feed abonnieren und werden von uns über neue Beiträge informiert.