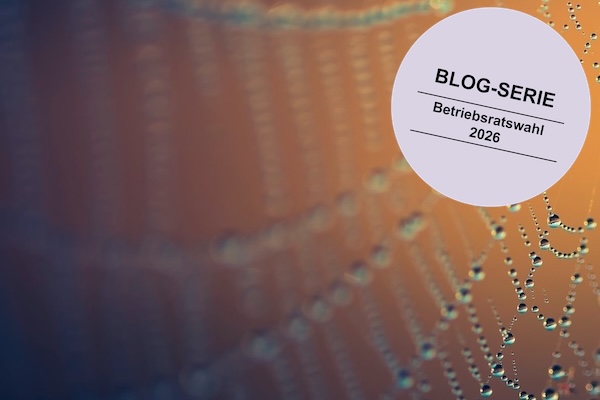Strukturvereinbarungen ermöglichen die Schaffung effektiver Betriebs- und Betriebsratsstrukturen. Dies gilt sowohl vor als auch nach der Betriebsratswahl.
Die gesetzlichen Betriebs- und Betriebsratsstrukturen sind starr und werden den Bedürfnissen der Praxis nicht immer gerecht. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die stetig voranschreitende Digitalisierung und Dezentralisierung der Arbeitswelt. Zudem kommt es im Zusammenhang mit Betriebsratswahlen regelmäßig zu Streit über die Frage, ob eine Einheit einen eigenständigen (betriebsratsfähigen) Betrieb darstellt und wo dessen Grenzen verlaufen.
Ein effektives Mittel zur Optimierung der Strukturen und Schaffung gesicherter Grundlagen für die Betriebsratswahl kann der Abschluss einer Strukturvereinbarung sein. Wichtig ist dabei eine frühzeitige Auswertung des Status Quo, die Festlegung der gewünschten Zielstruktur sowie die Prüfung der mit dem Abschluss einer Strukturvereinbarung einhergehenden möglichen (Rechts-)Folgen. Zeitliche Leitplanken können insbesondere anstehende Betriebsratswahlen bilden.
§ 3 BetrVG eröffnet die Möglichkeit, durch Strukturvereinbarungen vom Gesetz abweichende Betriebs- und Betriebsratsstrukturen zu schaffen
Regelungsgegenstand von Strukturvereinbarungen können die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats (Nr. 1a), das Zusammenfassen von Betrieben (Nr. 1b) sowie die Bildung von Spartenbetriebsräten (Nr. 2), anderen Arbeitnehmervertretungsstrukturen (Nr. 3), Arbeitsgemeinschaften und zusätzlichen betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmervertretungen (Nr. 5) sein.
Da in der Praxis die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats sowie das Zusammenfassen von Betrieben die häufigsten Anwendungsfälle von Strukturvereinbarungen darstellen, liegt der Schwerpunkt dieses Beitrags auf diesen beiden Varianten.
Festlegung von Betriebs- und Betriebsratsstrukturen durch Vereinbarung schafft Rechtssicherheit
Bestimmen sich die betriebsverfassungsrechtlichen Organisationsstrukturen nach dem Gesetz ist der Betriebsbegriff des § 1 Abs. 1 S. 1 BetrVG maßgeblich. Dabei definiert die Rechtsprechung den Betrieb als organisatorische Einheit, innerhalb derer ein Arbeitgeber* mit Hilfe materieller und immaterieller Betriebsmittel zusammen mit den von ihm beschäftigten Arbeitnehmern bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt (st. Rspr. BAG, Beschluss v. 23. September 1982 – 6 ABR 42/81). Diese Definition und ihre Voraussetzungen erscheinen auf den ersten Blick wenig Schwierigkeiten zu bereiten. Schaut man genauer hin, enthalten das Gesetz und die Rechtsprechung jedoch eine Vielzahl von Konkretisierungen und Differenzierungen. So gelten Betriebsteile mit in der Regel mindestens fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, als eigenständige Betriebe, wenn sie entweder räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt oder durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig sind (§ 4 Abs. 1 S. 1 BetrVG). Werden in einem Betrieb die vorstehenden Schwellenwerte nicht erreicht, ist der Betrieb dem Hauptbetrieb zuzuordnen (§ 4 Abs. 2 BetrVG). Setzen zwei oder mehr Unternehmen ihre Arbeitnehmer und Betriebsmittel zur Verfolgung eines gemeinsamen arbeitstechnischen Zwecks ein, wird das Bestehen eines Gemeinschaftsbetriebs vermutet (§ 1 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BetrVG).
Eine allgemeingültige Definition, wann eine Entfernung „weit“ ist, wann „Eigenständigkeit“ vorliegt, wann eine „gemeinsame Zweckverfolgung“ anzunehmen ist oder welcher Betrieb von mehreren Betrieben als „Hauptbetrieb“ gilt, lässt sich weder dem Gesetz noch der Rechtsprechung entnehmen. Die Frage des Bestehens eines oder mehrerer Betriebe und deren Abgrenzung voneinander ist daher regelmäßig Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Dies gilt auch und insbesondere im Zusammenhang mit Betriebsratswahlen. Denn es gilt der Grundsatz: Ein Betrieb, ein Betriebsrat. Erfolgt eine Wahl unter Verkennung des Betriebsbegriffs, droht die Anfechtung, in Extremfällen auch die Nichtigkeit der Wahl. Dies verdeutlicht nicht nur die Komplexität der Thematik, sondern auch das Bedürfnis nach Rechtssicherheit. Hinzu kommt, dass die tatsächlich gelebte Arbeitsweise und Struktur oftmals nicht mit dem schematischen und starren gesetzlichen Betriebsbegriff sowie dessen Grenzen übereinstimmen.
Die Festlegung von Betriebs- und Betriebsratsstrukturen durch Vereinbarung ermöglicht die Schaffung nahezu maßgeschneiderter Lösungen, mittels derer gesicherte Grundlagen für Betriebsratswahlen und die tägliche Zusammenarbeit in mitbestimmungsrelevanten Angelegenheiten etabliert werden können.
Voraussetzungen eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats / des Zusammenfassens von Betrieben
Die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats sowie das Zusammenfassen von Betrieben unterliegen im Wesentlichen denselben Voraussetzungen. In beiden Varianten gilt: Alle betroffenen Betriebe müssen demselben Unternehmen angehören und die Bildung bzw. das Zusammenfassen muss entweder die Errichtung von Betriebsräten (tatsächlich) erleichtern oder der Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen dienen. Soll ein unternehmenseinheitlicher Betriebsrat gebildet werden, ist zusätzliche Voraussetzung, dass die Zielerreichung, d.h. die Erleichterung der Betriebsratsbildung oder das Dienen der Arbeitnehmerinteressen, nicht durch das Zusammenfassen einzelner Betriebe als weniger einschneidende Maßnahme erreicht werden kann (BAG, Beschluss v. 24. April 2013 – 7 ABR 71/11). An der Zugehörigkeit aller Betriebe zum selben Unternehmen fehlt es im Falle des Vorliegens eines Gemeinschaftsbetriebs (BAG, Beschluss v. 13. März 2013 – 7 ABR 70/11).
Eine tatsächliche Erleichterung der Bildung von Betriebsräten hat die Rechtsprechung insbesondere für den Fall anerkannt, dass andernfalls die Gefahr der Nicht-Wahl in einzelnen Betrieben besteht (BAG, Beschluss v. 24. April 2013 – 7 ABR 71/11) oder die Wahl nach der gesetzlichen Struktur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre (vgl. Arbeitsgericht Dresden, Beschluss v. 19. Juni 2008 – 5 BV 25/08). Ein Dienen der Arbeitnehmerinteressen ist nach der Gesetzesbegründung und der Rechtsprechung beispielsweise gegeben, wenn Entscheidungen in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten zentralisiert getroffen werden (BT-Drs. 14/5741, 34) oder die Beteiligung von Arbeitnehmern nicht betriebsratsfähiger Einheiten gefördert bzw. ein betriebsratsloser Zustand verhindert wird (vgl. LAG Niedersachsen, Beschluss v. 22. August 2008 – 12 TaBV 14/08). Dabei kommt den Parteien der Strukturvereinbarung eine Einschätzungsprärogative in Bezug auf die Frage zu, ob die Maßnahmen der Wahrnehmung der Interessen „dient“ (BAG, Beschluss v. 24. Oktober 2013 – 7 ABR 71/11). Es reicht insofern aus, wenn das Ziel nachvollziehbar verfolgt und die Erreichung nicht von vornherein ausgeschlossen ist; ein objektiver Erfolgseintritt ist nicht erforderlich (vgl. BAG, Beschluss v. 13. März 2013 – 7 ABR 70/11). Die Anforderungen an entsprechende Vereinbarungen sind daher vergleichsweise gering (BAG, Beschluss v. 18. November 2014 – 1 ABR 21/13).
Strukturvereinbarung in Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung festlegen
Strukturvereinbarungen können – abhängig von ihrem Regelungsgegenstand – in Form eines Tarifvertrags oder einer Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden. Die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats oder das Zusammenfassen von Betrieben durch Betriebsvereinbarung kommt allerdings nur dann in Betracht, wenn keine tariflichen Regelungen gelten (§ 3 Abs. 2 BetrVG). Dabei tritt die Sperrwirkung bereits dann ein, wenn irgendeine tarifliche Regelung gilt. Voraussetzung ist lediglich eine beiderseitige gesetzliche Tarifbindung. Damit schließt jede tarifliche Regelung – gleich ob Verbands- oder Firmentarifvertrag, und unabhängig davon, ob sie (zumindest auch) die betriebsverfassungsrechtlichen Organisationsstrukturen betrifft – den Abschluss einer Betriebsvereinbarung aus (LAG München, Beschluss v. 11. August 2011 – 2 TaBV 5/11; BT-Drs. 14/5741, 34).
Auswertung der bestehenden Strukturen und Festlegung der Zielstruktur
Sollen neue Betriebs- und Betriebsratsstrukturen geschaffen werden, gilt es zunächst, eine Bestandsaufnahme der bestehenden Strukturen durchzuführen.
- Richten sich die bestehenden Betriebs- und Betriebsratsstrukturen nach dem Gesetz?
- Oder bestehen (vielleicht in Vergessenheit geratene) Strukturvereinbarungen aus der Vergangenheit?
- Bilden die aktuellen Strukturen die individuellen Bedürfnisse in der Praxis ab?
- Welche Struktur passt am besten zur tatsächlichen Arbeitsweise?
Diese und viele weitere Fragen gilt es zu stellen und zu beantworten. In Abhängigkeit von der Beantwortung der vorstehenden Fragen ist sodann die Zielstruktur festzulegen.
Prüfung der Rechtsfolgen der Zielstruktur
Wichtig ist, mögliche (Rechts-)Folgen der geplanten Zielstruktur frühzeitig zu prüfen und in die Bewertung des weiteren Vorgehens einzubeziehen. Zu berücksichtigen sind insofern insbesondere die Folgen für den Betrieb, den Betriebsrat und die Betriebsvereinbarungen. Die wesentlichen Rechtsfolgen der Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats und des Zusammenfassens von Betrieben lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Rechtsfolgen für den Betrieb: Die aufgrund einer Strukturvereinbarung gebildeten betriebsverfassungsrechtlichen Organisationseinheiten gelten als Betriebe im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes (§ 3 Abs. 5 S. 1 BetrVG). Die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats führt dementsprechend zur Fiktion eines (einzigen) einheitlichen Betriebs. Werden Betriebe zusammengefasst, gilt/gelten die gebildete(n) Einheit(en) als Betrieb(e). Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Fiktionswirkung nur dann eingreift, wenn der Betriebsbegriff i.S.d. Betriebsverfassungsgesetzes maßgeblich ist (z.B. § 3 DrittelbG/MitbestG). Die Fiktion erstreckt sich insofern insbesondere nicht auf das Kündigungsrecht und die Sozialauswahl (BAG, Urteil v. 31. Mai 2007 – 2 AZR 276/06; zur Massenentlassung BAG, Urteil v. 13. Februar 2020 – 6 AZR 146/19).
- Rechtsfolgen für den Betriebsrat: Die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats hat zur Folge, dass ein (einziger) Betriebsrat für alle Betriebe des Unternehmens gebildet wird. Werden mehrere Betriebe zusammengefasst, kann gemäß dem Grundsatz „ein Betrieb, ein Betriebsrat“ in jeder der gebildeten Betriebseinheiten ein Betriebsrat gebildet werden. Die Rechte und Pflichten der Betriebsräte, die in durch Strukturvereinbarungen gebildeten Betrieben gewählt wurden, bestimmen sich nach den allgemeinen Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes (§ 3 Abs. 5 S. 2 BetrVG). Sie entsprechen damit denen eines „normalen“ Betriebsrats. Werden mehrere Betriebseinheiten gebildet und Betriebsräte gewählt, können diese einen Gesamtbetriebsrat (§§ 47 ff. BetrVG) bilden. Bei der Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats scheidet die Errichtung eines Gesamtbetriebsrats mangels Bestehens mehrerer Betriebsräte aus. Die Frage, ob und wenn ja, welchem von mehreren Betriebsräten bei Einführung einer gewillkürten Struktur ein Übergangsmandat zusteht, ist jeweils anhand des konkreten Einzelfalles unter Berücksichtigung der jeweiligen Gesamtumstände zu prüfen, wobei zwischen einem Zusammenschluss zur Neugründung und einem Zusammenschluss zur Aufnahme zu differenzieren ist.
- Rechtsfolgen für Betriebsvereinbarungen: Bestehen die bisherigen Betriebe in der kraft Vereinbarung gebildeten Betriebseinheit als abgrenzbare Betriebsteile fort, bleiben die bisherigen Betriebsvereinbarungen unberührt und gelten beschränkt auf den Betriebsteil ihres bisherigen Geltungsbereichs fort (BAG, Beschluss v. 18. März 2008 – 1 ABR 3/07). Im Übrigen bedarf es auch hier einer Einzelfallprüfung, wobei wiederum zwischen den verschiedenen Arten des Zusammenschlusses zu differenzieren ist.
Dass eine frühzeitige Einbeziehung der Rechtsfolgen in die Entscheidungsfindung bzgl. der Zielstruktur von erheblicher Bedeutung ist, wird am Beispiel der Arbeitszeit besonders deutlich. Haben in den bisherigen Betrieben unterschiedliche Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle und/oder Schichtsysteme gegolten, muss klar sein, nach welchen Regelungen sich die Arbeitszeit in dem neuen Betrieb richtet. Um im Hinblick auf die (Nicht-)Geltung bisheriger Betriebsvereinbarungen Rechtssicherheit zu schaffen empfiehlt es sich insofern regelmäßig, frühzeitig die Verhandlungen über eine Überleitungsvereinbarung aufzunehmen. Entsprechendes gilt in Bezug auf das (Nicht-)Bestehen eines Übergangsmandats der Betriebsräte.
Grenzen der Strukturvereinbarung
Die Grenzen einer Strukturvereinbarung ergeben sich in Abhängigkeit ihres konkreten Regelungsgegenstandes. In Bezug auf die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats und das Zusammenfassen von Betrieben ist eine maßgebliche Grenze in dem weiten Tarifvorbehalt zu sehen, der den Weg über den Abschluss einer Strukturvereinbarung in Form einer Betriebsvereinbarung in der Praxis oftmals sperrt. Weitere Grenzen liegen in den einzelnen Wirksamkeitsvoraussetzungen, z.B. der (tatsächlichen) Erleichterung bzw. dem Dienen der Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen. Wurde eine Strukturvereinbarung wirksam abgeschlossen, endet ihr Wirkungskreis an den Grenzen des Betriebsverfassungsgesetzes. Der Betriebsbegriff im Sinne anderer Rechtsvorschriften steht nicht zur Disposition der Parteien einer Strukturvereinbarung.
Strukturvereinbarungen gezielt nutzen: Effiziente Betriebs- und Betriebsratsstrukturen schaffen und kommende Wahlen rechtssicher vorbereiten
Strukturvereinbarungen können ein effektives Mittel zur Steigerung der Effizienz der Betriebs- und Betriebsratsstrukturen darstellen. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, gesicherte Grundlagen für Betriebsratswahlen und die mitbestimmungsrechtliche Zusammenarbeit in der täglichen Praxis zu schaffen. Wichtig ist dabei, die (Rechts-)Folgen der Vereinbarung frühzeitig zu bewerten und ihre Grenzen im Blick zu behalten.
* Gemeint sind Personen jeder Geschlechtsidentität. Um der leichteren Lesbarkeit willen wird im Beitrag die grammatikalisch männliche Form verwendet.