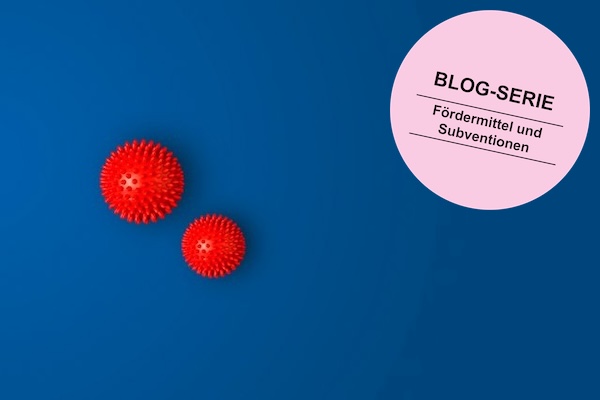Verbundene Unternehmen müssen bei mehrfach gewährten Corona-Hilfen mit Rückforderungen rechnen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster erneut bestätigt.
Bis zum 30. September 2024 war von den Empfängern* der Corona-Hilfen eine Schlussabrechnung bei der zuständigen Bewilligungsbehörde einzureichen. Nach einer Prüfung der Schlussabrechnungen haben die zuständigen Bewilligungsbehörden gegenüber Unternehmen in verschiedenen Einzelfällen Rückforderungsbescheide erlassen. Die Rückforderungsbescheide werden häufig vor den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit angegriffen, sodass hierzu in jüngster Zeit auch obergerichtliche Entscheidungen ergangen sind.
Das Oberverwaltungsgericht Münster erklärte mit Urteilen vom 15. Mai 2025 (Az.: 4 A 2550/22, 4 A 2551/22, 4 A 274/23) die Gewährung von Corona-Hilfen an mehrere Unternehmen eines Unternehmensverbunds für rechtswidrig. Damit setzt das Gericht seine bereits mit Urteil vom 6. März 2024 (Az.: 4 A 1581/23) vorgezeichnete Rechtsprechungslinie zu verbundenen Unternehmen fort. Verbundene Unternehmen seien als ein Unternehmen zu behandeln und deshalb lediglich einmalig zum Empfang der jeweiligen Corona-Hilfen berechtigt. Verbundene Unternehmen müssten außerdem gemeinsam die Anforderungen des beihilferechtlichen Rahmens und der nationalen Förderbedingungen erfüllen. Ob auch das Bundesverwaltungsgericht über diese Fragen zu befinden haben wird, ist offen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die Revision nicht zugelassen, sodass den Klägern nur die Möglichkeit einer Nichtzulassungsbeschwerde offen steht.
Gewährung von Corona-Soforthilfen
Ab dem Frühjahr 2020 reagierte die Bundesregierung mit der Einführung von Corona-Hilfen auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der staatlichen Corona-Beschränkungen. Ziel war es, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen für einen befristeten Zeitraum schnell finanzielle Unterstützung zu bieten, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken und die Existenz der Unternehmen zu sichern.
Die Corona-Hilfen wurden als Fixkostenzuschüsse des Bundes in verschiedenen Programmen gewährt. Zu den Programmen gehörten die außerordentlichen Wirtschaftshilfen, d.h. die Novemberhilfe und die Dezemberhilfe für Umsatzausfälle im November und Dezember 2020 sowie die Überbrückungshilfen I, II, III, III Plus und IV, die Umsatzausfälle in den Monaten Juni 2020 bis Juni 2022 abdecken sollten. Die Corona-Hilfen wurden allerdings in der Regel nur vorläufig und vorbehaltlich einer endgültigen Festsetzung in einem Schlussbescheid bewilligt. Die Zuwendungsempfänger waren daher verpflichtet, Schlussabrechnungen einzureichen, auf deren Grundlage die Bewilligungsbehörden Schlussbescheide erlassen. Erlässt die Bewilligungsbehörde aufgrund der endgültigen Festsetzung der Förderhöhe im Schlussbescheid einen Rückforderungsbescheid, können hiergegen Rechtsbehelfe (Widerspruch oder Klage) eingelegt werden. Dabei sollte sowohl der Schluss- als auch der Rückforderungsbescheid angegriffen werden. Nur wenn die Behörde die beiden Bescheide miteinander verbindet, genügt ein einziger Rechtsbehelf.
Grundlage der nationalen Regelwerke war die Mitteilung der Europäischen Kommission „Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19“ (2020/C 91 I/01) vom 20. März 2020. Darin erklärte die Europäische Kommission die Gewährung staatlicher Beihilfen für einen befristeten Zeitraum mit dem Binnenmarkt vereinbar.
Aktuelle Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Münster
Die Urteile des Oberverwaltungsgerichts Münster haben Rückforderungsbescheide von Corona-Hilfen zum Gegenstand. Anders als in der Vorinstanz bestätigte das Oberverwaltungsgericht Münster die Rücknahme bewilligter Corona-Hilfen in mehreren Fällen. Die Rücknahme betraf Unternehmen, die Corona-Hilfen als Einzelunternehmen beantragt hatten, nach den Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts Münster tatsächlich jedoch Teil eines größeren Unternehmensverbundes waren. Diese Zusammenhänge hatten die Unternehmen im Antragsformular nicht oder nur unvollständig offengelegt. Laut dem Oberverwaltungsgericht Münster stellt dies einen Verstoß gegen die beihilferechtlich genehmigte Bundesregelung Kleinbeihilfen dar, wonach nur ein einziges Unternehmen eines Unternehmensverbundes Corona-Hilfen erhalten durfte. Aus diesem Grund stufte das Oberverwaltungsgericht Münster die zugrunde liegenden Bescheide als rechtswidrig ein.
Begriff des verbundenen Unternehmens
Das Oberverwaltungsgericht Münster hat in seinen Urteilen angenommen, dass für die Prüfung eines Unternehmensverbunds die beihilferechtliche Betrachtung maßgeblich sei, ob mehrere Unternehmen eine wirtschaftliche Einheit bilden. Das Gericht lehnt sich dabei an Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Definition des „verbundenen Unternehmens“ aus Art. 3 Abs. 3 UAbs. 1 Anhang I der Gruppenfreistellungsverordnung (VO (EU) 651/2014) an. Ausschlaggebend sei dabei nicht die formale rechtliche Selbstständigkeit oder die Art der Finanzierung der einzelnen Unternehmen. Maßgeblich dafür, ob eine wirtschaftliche Einheit vorliegt, sei das Bestehen von Kontrollbeteiligungen und anderer funktioneller, wirtschaftlicher und institutioneller Verbindungen zwischen den Unternehmen. Insbesondere könnten Unternehmen bereits aufgrund der Rolle einer Person oder einer Gruppe mehrerer Personen als verbunden angesehen werden, auch wenn diese Unternehmen formal nicht in einer der in Art. 3 Abs. 3 UAbs. 1 Anhang I der Gruppenfreistellungsverordnung (VO (EU) 651/2014) aufgeführten Beziehungen zueinanderstehen. Dies sei nach dem Oberverwaltungsgericht Münster der Fall, wenn eine Person oder eine Gruppe mehrerer Personen durch gemeinsames Handeln und Abstimmen Einfluss auf die geschäftlichen Entscheidungen der betreffenden Unternehmen ausüben würden.
So genügte in dem aktuell vom Oberverwaltungsgericht Münster mit Urteil vom 15. Mai 2025 entschiedenen Fall bereits die Beherrschung durch einen Einzelunternehmer über mehrere rechtlich getrennte Gesellschaften, um die Antragsberechtigung wegen fehlender Unabhängigkeit zu verneinen und einen Unternehmensverbund zu bejahen. In dem anderen, ebenfalls vom Oberverwaltungsgericht Münster mit Urteil vom 6.3.2024 entschiedenen Verfahren, wurde ein Unternehmen als Teil eines verbundenen Unternehmens betrachtet, weil eine Muttergesellschaft Anteile an mehreren Tochtergesellschaften hielt und die zentrale Steuerung der Gesellschaften übernahm.
Kein Vertrauensschutz oder Ermessensfehler
Die betroffenen Unternehmen beriefen sich auf Vertrauensschutz und verwiesen auf Ermessensfehler der Behörde. Man habe in gutem Glauben gehandelt, das Antragsformular sei missverständlich gewesen, und die Verwaltung habe dies im Einzelfall nicht beanstandet. Das Oberverwaltungsgericht Münster ließ diese Argumente nicht gelten.
Verwaltungsakte, die durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden seien, könnten mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit einer unionsrechtswidrig gewährten Beihilfe sei laut Oberverwaltungsgericht Münster nach ständiger EuGH-Rechtsprechung nur dann schutzwürdig, wenn klare, unbedingte und von einer zuständigen Unionsbehörde stammende Zusicherungen vorliegen – was in keinem der Fälle gegeben war. Auch die teilweise missverständliche Gestaltung der Antragsformulare änderte nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts Münster nichts an der unionsrechtlichen Verpflichtung der Behörde zur Rücknahme. Dies unterstreicht das umfassende Gebot der Rückforderung staatlicher Zuwendung bei Verstößen gegen das Europarecht. Die Frage einer Amtshaftung der Behörde, die die missverständlichen Antragsformulare vorgegeben hatte, erörtert das Oberverwaltungsgericht Münster hingegen nicht.
Geltung auch für andere Corona-Hilfen
Die Urteile des Oberverwaltungsgerichts Münster haben große Bedeutung für Unternehmen, die Corona-Hilfen für mehrere Betriebsteile oder Tochtergesellschaften getrennt beantragt und erhalten haben. Aus der Definition des Unternehmens als wirtschaftliche Einheit und der Anwendung des europäischen Beihilfenrechts folgt, dass im Zusammenhang mit Corona-Hilfen auch formal unabhängige Gesellschaften in einem Konzern- oder Beteiligungsgefüge gemeinsam zu betrachten sind. Für Unternehmen drohen vor diesem Hintergrund Rückforderungsrisiken.
Wenn die Bewilligungsbehörde aus diesen Gründen bei Unternehmen eine Rückforderung festsetzt, sollte der betroffene Zuwendungsempfänger die Rechtmäßigkeit der Rückforderung überprüfen und gegebenenfalls rechtzeitig von seinen Rechtsschutzmöglichkeiten Gebrauch machen, um seine Rechte zu wahren. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Münster um Entscheidungen im Einzelfall handelt und sich abhängig vom Sachverhalt jedes Einzelfalls unterschiedliche Verteidigungsmöglichkeiten gegen Rückforderungen ergeben können.
Wir freuen uns, dass Sie unsere Blogserie „Fördermittel und Subventionen“ begleiten. Weitere Beiträge folgen!
* Gemeint sind Personen jeder Geschlechtsidentität. Um der leichteren Lesbarkeit willen wird im Beitrag die grammatikalisch männliche Form verwendet.