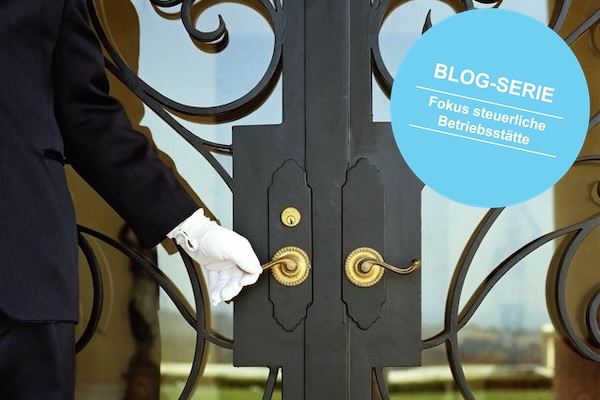Dienstleister agieren heute vielfach grenzüberschreitend. Doch wann begründet ihre Tätigkeit beim Auftraggeber für die Dienstleister eine Betriebsstätte?
In vielen Fällen werden in einer globalisierten Arbeitsteilung Dienstleister für ihre Auftraggeber tätig. Mitunter werden entsprechende Dienste auch längerfristig erbracht, insbesondere wenn die Zusammenarbeit von vornherein auf Dauer angelegt ist oder aber sich einzelne Projekte doch als zeitintensiver erweisen. In diesen Konstellationen kann sich aus Sicht des Dienstleisters die Frage stellen, ob durch die Tätigkeit eine Betriebsstätte begründet wird, insbesondere wenn die Tätigkeiten in den Räumen des Auftraggebers erfolgt, die dieser hierfür zur Verfügung stellt.
Erkennt die Finanzverwaltung nachträglich eine solche Dienstleistungsbetriebsstätte, kann dies zu erheblichen Steuernachzahlungen für die Vergangenheit führen, während die erwirtschafteten Einkünfte in der Regel im Ausland bereits besteuert sein werden. Gerade deshalb aber kann es sich lohnen, die steuerlichen Folgen der Dienstleistungserbringung im Voraus zu evaluieren.
Abkommensrechtliche Anforderungen an die Dienstleistungsbetriebsstätte
Ausdrückliche Vorgaben dazu, dass bereits die Erbringung von Dienstleistung über einen gewissen Zeitraum hinweg zu einem dortigen Besteuerungsrecht führen, bestehen nur in wenigen Doppelbesteuerungsabkommen. Entsprechende Regelungen enthalten etwa das überaus praxisrelevante DBA-China, aber auch das DBA-Türkei und das DBA-Australien sehen spezielle Vorschriften hierzu vor.
Was aber, wenn – wie in den meisten Fällen – eine entsprechende Regelung nicht für entsprechende Rechtsklarheit sorgt? Hierzu hatte der BFH in der Vergangenheit bereits klargestellt, dass das bloße Tätigwerden in den Räumen des Auftraggebers grundsätzlich keine Betriebsstätte begründet. Entscheidend ist jedoch stets der allgemeine Begriff der Betriebsstätte des jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommens, d.h. es gilt zu prüfen, ob der Dienstleister am Ort seiner Tätigkeit über eine feste Geschäftseinrichtung verfügt, durch die die Geschäftstätigkeit seines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird.
Maßgeblich ist eine hinreichende Verwurzelung am Ort der Tätigkeit
Wann diese Voraussetzungen im Falle der Erbringung von Dienstleistungen am Ort des Auftraggebers erfüllt sein können, hatte sich der BFH in der Vergangenheit bereits mehrfach zu befassen. Entscheidend soll aus Sicht des BFH insofern sein, ob am Ort der Ausübung der Dienstleistung eine hinreichende Verwurzelung im Sinne einer festen örtlichen Bindung besteht. Nur dann werde überhaupt eine eigene unternehmerische Tätigkeit mit fester örtlicher Bindung ausgeübt.
Neben der Dauer der Tätigkeit selbst soll es dazu entscheidend darauf ankommen, ob der Dienstleister eine entsprechende Verfügungsmacht über die ihm vom Auftraggeber überlassenen Räumlichkeiten hat. Dass die Schwelle dabei nicht allzu hoch anzusetzen ist, hat der BFH zuletzt in seinen beiden Spind-Entscheidungen vom 9. Januar 2019 (Az. I B 138/17) und vom 7. Juni 2023 (Az. I R 47/20) klargestellt.
So hat der BFH entschieden, dass bereits das Vorhalten eines Spindes, über den der Steuerpflichtige aufgrund entsprechender Nutzungsvereinbarung verfügen konnte, eine Betriebsstätte des Steuerpflichtigen nach internationalem Steuerrecht nach dem einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen, aber auch nach nationalem Recht im Sinne des § 12 AO begründete.
Vertragliche Nutzungsmöglichkeiten können entscheidend sein
Entscheidend war dabei, dass im konkreten Fall ein selbständiger Nutzungsanspruch des Dienstleisters bestand. Der BFH stellte insofern erneut klar, dass allein die tatsächliche Mitbenutzung sowie die bloße Nutzungsmöglichkeit den Anforderungen einer Betriebsstätte nicht genügen.
Zugleich wird aber auch deutlich, dass die Nutzungsmöglichkeit nicht zwingend eine Alleinige sein muss. So war es etwa unschädlich, dass sich der Steuerpflichtige vor Nutzung seines Spindes Sicherheitskontrollen am Eingang des Flughafens unterziehen musste. Ebenso sprach es nicht gegen eine Verfügungsmacht, dass dem Steuerpflichtigen die Nutzungsmöglichkeit vom Auftraggeber ohne seinen Einfluss jederzeit wieder hätte entzogen werden können. Hinzu kommt, dass das Nutzungsrecht im Streitfall auch nur mittelbar aus einer Vereinbarung mit einem Dritten abgeleitet worden war. Die Anforderungen an die Herleitung eines Nutzungsanspruchs sind daher eher niedrig und orientieren sich nicht an den strengen Maßstäben des Zivilrechts.
Geringe Anforderungen an Größe und Umfang der Nutzung
Bemerkenswert ist, dass bereits sehr eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten – wie etwa ein Spind oder Schließfach – den Charakter einer Betriebsstätte begründen können. Entscheidend ist nicht, ob in der Einrichtung selbst produktiv gearbeitet wird und auch die Größe spielt eine allenfalls untergeordnete Rolle. Maßgeblich ist vielmehr, dass die Einrichtung in die Leistungserbringung des Dienstleisters so eingebunden ist, dass sie die erforderliche ortsbezogene „Verwurzelung“ des Unternehmens mit dem Tätigkeitsort begründet. Die Anforderungen sind auch insoweit eher niedrig, wie der BFH in seinem Urteil vom 7. Juni 2023 deutlich macht, indem er bereits die Aufbewahrung betrieblicher- aber auch privater Kleidung im Spind genügen ließ.
Besonderheiten bei Immobilien und Auftraggeber-Betriebsstätte
Auch im Immobiliensektor stellen sich praxisrelevante Fragen, die frühzeitig betrachtet werden sollten. Zwar begründet eine vermietete Immobilie im Inland durch einen ausländischen Investor in der Regel keine inländische Betriebsstätte. Wird jedoch eine Dienstleistungs- oder Managementgesellschaft mit der Betreuung beauftragt, kann dies im Einzelfall anders zu beurteilen sein. Eine genaue Analyse der vertraglichen und tatsächlichen Gestaltung ist hier unerlässlich.
Darüber hinaus kann sich die Betriebsstätten-Thematik auch in umgekehrter Richtung stellen: So kann die Einbindung eines Dienstleisters unter bestimmten Umständen zur Begründung einer Betriebsstätte beim Auftraggeber führen. Maßgeblich sind hierbei insbesondere Art und Umfang der erbrachten Leistungen sowie der Grad der organisatorischen Eingliederung des Dienstleisters in den Betrieb des Auftraggebers.
Handlungsbedarf vor Ort: Dienstleister sollten prüfen
Die Entscheidungspraxis zeigt, dass eine Betriebsstätte schneller begründet sein kann, als häufig angenommen – insbesondere bei bloßer Dienstleistungserbringung vor Ort. Ein gesonderter Arbeitsbereich oder gar ein eigenes Büro ist dazu nicht zwingend erforderlich – ein Spind oder Schließfach kann bereits genügen, wenn hierzu – womöglich nur beiläufig und aus praktischen Erwägungen heraus – Absprachen über eine Nutzung getroffen werden. Dienstleister sollten daher frühzeitig prüfen, ob ihre Tätigkeit vor Ort mit einer organisatorischen und örtlichen Bindung verbunden ist, die zur Annahme einer Betriebsstätte führen könnte.
In unserer Blogserie „Fokus steuerliche Betriebsstätte″ informieren wir Sie umfassend über alle praxisrelevanten Fallgestaltungen, rechtliche Besonderheiten sowie die sachgerechte Handhabung begründeter Betriebsstätten.