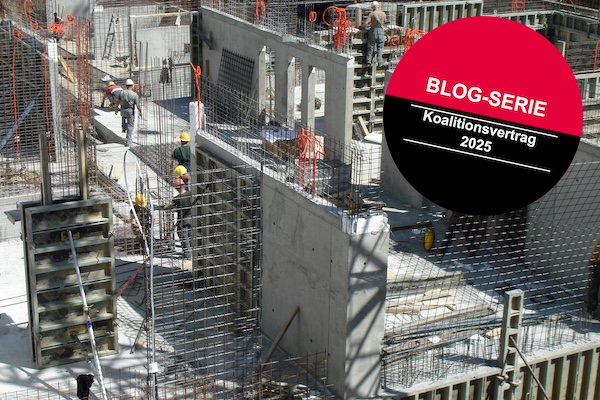Der Koalitionsvertrag steht. Worauf muss sich die Immobilienwirtschaft einstellen?
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode steht. Wir fassen die wichtigsten Vorhaben mit Bedeutung für die Immobilienwirtschaft zusammen.
Maßnahmenbündel mit Ziel der Stärkung des (Wohnungs-)Neubaus
Das Baugesetzbuch (BauGB) soll in zwei Schritten novelliert werden. In den ersten 100 Tagen soll es einen Gesetzesentwurf für einen „Wohnungsbau-Turbo“ geben, anschließend eine grundlegende Reform zur Beschleunigung des Bauens. Die TA Lärm, die TA Luft und das Bauplanungsrecht sollen weiterentwickelt werden, um Nutzungskonflikte zwischen Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft besser lösen zu können. Ferner sollen Baustandards abgebaut und der Gebäudetyp E rechtlich abgesichert werden. Hier kann auf Vorarbeit der Ampelregierung zurückgegriffen werden. Das Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik soll künftig keinen Mangel mehr darstellen. Das dürfte jedenfalls für den Gebäudetyp E gelten. Der Koalitionsvertrag bekennt sich ferner zum seriellen, modularen und systemischen Bauen, womit Beschleunigungspotentiale gehoben werden sollen. Auch die Rolle der kommunalen Wohnungsbauunternehmen soll gestärkt werden.
Flankierung durch weitere Fördermaßnahmen
Zur Neubauförderung und zur Sanierung bestehenden Wohnraums sollen steuerliche Maßnahmen verbessert, eigenkapitalersetzende Maßnahmen geschaffen und die Übernahme staatlicher Sicherheiten geprüft werden. Die Förderprogramme der KfW sollen zu zwei zentralen Programmen zusammengeführt werden: eines für den Neubau und eines für die Modernisierung. Zeitlich befristet soll auch der EH55-Standart wieder gefördert werden, um Bauvorhaben zu reaktivieren. Zur Vergabe von Eigen- und Fremdkapital soll zudem ein Investitionsfonds für den Wohnungsbau aufgelegt werden. Die Finanzierungskosten für Bautätigkeiten sollen durch staatliche Unterstützung gesenkt werden. Als Ziel gibt der Koalitionsvertrag aus, dass in angespannten Wohnungsmärkten in großer Zahl Wohnungen für eine Kaltmiete von EUR 15,00 pro Quadratmeter entstehen. Betont werden in diesem Zusammenhang auch die Expertise der und die Kooperation mit der Wohnungswirtschaft.
Mietenregulierung wird ausgebaut
Die Mietpreisbremse in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten läuft nach bisherigem Recht zum 31.12.2025 aus. Sie soll laut Koalitionsvertrag nunmehr um vier Jahre verlängert werden, nachdem während der Koalitionsverhandlungen noch von zwei Jahren die Rede war. Eine Expertenkommission soll bis zum 31.12.2026 Vorschläge zur Weiterentwicklung der Mietenregulierung machen, wozu auch Bußgeldvorschriften für Verstöße gegen die Mietpreisbremse gehören. Bisher ist keine solche Sanktion vorgesehen.. Im Übrigen sollen in angespannten Wohnungsmärken Indexmieten bei der Wohnraumvermietung, möblierte und Kurzzeitvermietungen einer erweiterten Regulierung unterworfen werden. Dies könnte Geschäftsmodelle von Serviced Living-Anbietern unter Druck setzen. Die während der Koalitionsverhandlungen kolportierten Forderungen nach einer verschärften Kappungsgrenze, einem Mietenstopp oder einem Mietendeckel sind nicht Teil des Koalitionsvertrags. Für Mieter vorteilhafte Änderungen soll es aber bei der Modernisierungsumlage und den Anforderungen an Nebenkostenabrechnungen geben. Schließlich soll eine nationale Mietenberichterstattung eingeführt werden.
Rechtsgrundlage für Umwandlungsverbote wird um fünf Jahre verlängert
Seit 2021 können Landesregierungen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten untersagen. Erlaubt werden Umwandlungen nur in bestimmten (Ausnahme-)Fällen. Davon haben u.a. Berlin, Hamburg, Bayern und Niedersachsen Gebrauch gemacht. Das Umwandlungsverbot läuft nach bisherigem Recht zum 31.12.2025 aus. Laut Koalitionsvertrag soll es nun fünf weitere Jahre gelten. Bisher durften zum Inkrafttreten des Umwandlungsverbots noch nicht bestehende Wohngebäude weiterhin umgewandelt werden, um den Neubau nicht zu ersticken. Je nach gesetzlicher Ausgestaltung der Verlängerung könnten zwischenzeitlich fertiggestellte Wohngebäude aber als Bestandsgebäude gelten und dem Umwandlungsverbot unterliegen. Der bis Ende 2025 bestehende Handlungsspielraum für solche Gebäude sollte ggf. also noch genutzt werden.
Kommunales Vorkaufsrecht wird gestärkt
Das kommunale Vorkaufsrecht soll u. a. in Milieuschutzgebieten soll gestärkt werden. Dies dürfte eine Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2021 sein, wonach mögliche milieuschutzwidrige Nutzungsabsichten des Käufers nicht ausreichen, um das milieuschutzrechtliche Vorkaufsrecht auszuüben. Damit hatte das Bundesverwaltungsgericht einer weitverbreiteten kommunalen Praxis, Käufer zum Abschluss sog. Abwendungsvereinbarungen zu zwingen, den Boden entzogen. Außerdem soll die Umgehung des kommunalen Vorkaufsrechts durch Share Deals verhindert werden. Auf die gesetzliche Ausgestaltung darf man gespannt sein. Ein entsprechender Vorstoß der Ampelregierung im Jahr 2024 war sehr durchwachsen, wurde aber nicht Gesetz.
Klimaschutz im Gebäudesektor findet weiterhin statt
Der Koalitionsvertrag bezeichnet den Gebäudesektor als zentral für die Erreichung der Klimaziele. Das Heizungsgesetz soll abgeschafft werden. Damit dürfte indes nur die Novelle des GEG aus der Zeit der Ampelregierung gemeint sein, nicht das GEG selbst. Dieses soll vielmehr technologieoffener, flexibler und einfacher werden. Zentrale Steuerungsgröße soll die erreichbare CO2-Vermeidung sein. Die Sanierungs- und Heizungsförderung soll aber fortgesetzt werden. Ferner sollen die Verzahnung von GEG und kommunaler Wärmeplanung vereinfacht und die nationalen Gebäudeeffizienzklassen im GEG mit den europäischen Nachbarländern harmonisiert werden. Die Koalitionspartner wollen sich schließlich für eine Verlängerung der Umsetzungsfristen der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) einsetzen, die nach bisherigem Recht bis zum 29.05.2026 in nationales Recht umzusetzen ist. Die bestehenden Spielräume bei der Umsetzung sollen ausgeschöpft werden.
Von Ansätzen zur Umsetzung
Zusammenfassend enthält der Koalitionsvertrag eine Reihe von Ansätzen, die (Wohnungs-)Neubau möglicherweise schneller und günstiger machen können. Um wirksam zu sein, müssen sie zum einen in praktikable Gesetze gegossen und zum anderen von den Verwaltungen unbürokratisch umgesetzt werden. Die im Koalitionsvertrag angesprochene generelle Entbürokratisierungsoffensive würde dabei gegebenenfalls helfen. Bei den zahlreichen weiteren Regulierungsmaßnahmen wird es spannend, wie diese handwerklich ausgestaltet werden.
Wir informieren Sie in unserer Blog-Serie zum Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD fortlaufend mit aktuellen Beiträgen zu diesem Thema. Sie können diese Blog-Serie über den RSS-Feed abonnieren und werden von uns über neue Beiträge informiert.