Geplante Zivilprozessreform im Koalitionsvertrag 2025: Digitalisierung, Effizienz & Struktur sollen die Justiz modernisieren – mit Chancen und Risiken für Unternehmen.
Mit dem Koalitionsvertrag 2025 unter dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ haben CDU/CSU und SPD tiefgreifende Reformen im Zivilverfahrensrecht angekündigt. Die im Koalitionsvertrag geplanten Reformen setzen klare Schwerpunkte auf die Modernisierung der Justiz, insbesondere durch Digitalisierung, Effizienzsteigerung und eine strukturierte Prozessführung. Dies ist nicht zuletzt eine Reaktion auf die in den letzten Jahren zunehmend auftretenden Massenverfahren, die erhebliche Ressourcen der Justiz beanspruchen.
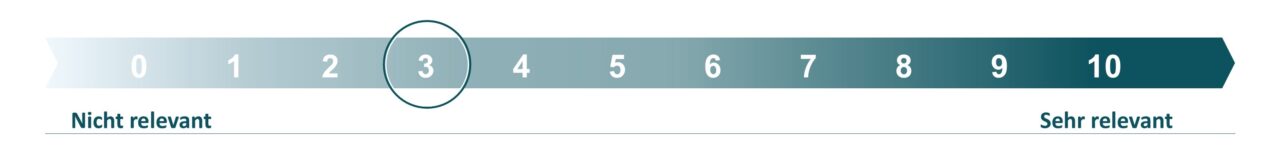
1. Digitalisierung der Justiz – Rechtsprechung im digitalen Raum
Die Bundesregierung plant eine konsequente Fortführung der Digitalisierung der Justiz. Geplant ist die Einführung einheitlicher Standards für die digitale Übermittlung von Dokumenten und Behördenakten (sog. „Bundesjustizcloud“), was eine schnellere und effizientere Kommunikation zwischen Gerichten, Staatsanwaltschaften und den Verfahrensbeteiligten ermöglichen soll. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die geplante Einführung eines Justizportals, das verschiedene Bürgerservices wie eine digitale Rechtsantragsstelle, den Zugang zum digitalen Rechtsverkehr und ein zentrales Vollstreckungsregister umfasst. Darüber hinaus soll ein Online-Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit eingeführt werden, das es ermöglicht, bestimmte rechtliche Streitigkeiten vollständig digital abzuwickeln. Ergänzend ist der verstärkte Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) vorgesehen, insbesondere zur Bewältigung von sog. Massenverfahren.
Für Mandant:innen bedeutet dies einerseits erhebliche Verbesserungen: Die Digitalisierung, vereinfachte Abläufe und beschleunigte Verfahrensführung könnten zu einer spürbaren Reduzierung der Verfahrensdauer führen. Besonders kleinere Unternehmen und Einzelpersonen profitieren voraussichtlich von den digitalen Angeboten, die den Zugang zum Recht und die Handhabung rechtlicher Angelegenheiten erleichtern. Gleichzeitig stellen sich jedoch kritische Fragen hinsichtlich der technischen Umsetzung. Insbesondere ist zu klären, ob die digitalen Verfahren in der Praxis zuverlässig, sicher und benutzerfreundlich funktionieren. Gerade im unternehmerischen Geschäftsverkehr mit sensiblen Daten bestehen erhöhte Anforderungen an Datenschutz und Vertraulichkeit. Ein zentrales Justizportal oder cloudbasierte Systeme bergen potenzielle Cybersecurity-Risiken, die sorgfältig überwacht werden müssen. Darüber hinaus könnten Unternehmen einem zunehmenden Automatisierungsgrad bei richterlicher Entscheidungsfindung ausgesetzt sein, ohne dass die Entscheidungsfindung stets transparent und nachvollziehbar ist (Transparenzproblem).
2. Zugang zum Recht – Stärkung der ersten Instanz
Zur Entlastung der Landgerichte wird eine Anhebung der streitwertabhängigen Zuständigkeit der Amtsgerichte nach § 23 Nr. 1 GVG angestrebt. Grund hierfür ist, dass die Zahl der erstinstanzlich bei den Amtsgerichten anhängig gemachten Zivilverfahren in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen ist (vgl. BT-Drucks. 20/13251). Die letzte Anpassung des für die Zuständigkeit der Amtsgerichte maßgeblichen Streitwertgrenze erfolgte 1993; der damalige Wert von 10.000 DM entspricht heute 5.000 Euro. Bereits die vorherige Bundesregierung hatte mit einem Gesetzesentwurf (BT-Drucks. 20/13251) die Anhebung des Zuständigkeitsstreitwerts von fünftausend auf achttausend Euro vorgeschlagen.
Die nunmehr vorgesehene Anhebung soll für eine Entlastung der höheren Instanzen sorgen und gleichzeitig den Zugang zu den Gerichten erleichtern. Denn die Belastung der Zivilkammern der Landgerichte insbesondere mit Massenverfahren in Form von zahlreichen parallelen Einzelklagen gegen Unternehmen im Kapitalanlage-, Verbraucherschutz-, Versicherungs- und Fluggastrecht ist weiterhin hoch. Der erleichterte Zugang zur Justiz könnten dazu führen, dass Mandant:innen künftig vermehrt Klagen von Verbraucher:innen ausgesetzt werden: Der Entfall des Anwaltszwangs (§ 78 Abs. 1 ZPO) vor Amtsgerichten und die geplanten Online-Verfahren senken die prozessuale Einstiegsschwelle für Privatpersonen deutlich. Dies könnte insbesondere im Bereich des Verbraucherrechts, etwa bei streitigen Rückabwicklungen, Gewährleistungsfällen oder Fluggastansprüchen, zu einer Zunahme paralleler Einzelverfahren führen – mit potenziellen Auswirkungen auf Ressourcen, Kosten und Reputationsrisiken.
Die hierdurch bedingte Zunahme erstinstanzlicher Verfahren vor den Amtsgerichten – insbesondere infolge einer Erhöhung der Streitwertgrenze nach § 23 Nr. 1 GVG – kann zu einer Zersplitterung der Rechtsprechung führen. Die Vielzahl örtlich zuständiger Amtsgerichte erhöht die Wahrscheinlichkeit divergierender Entscheidungen in vergleichbaren Sachverhalten bzw. sog. Massenverfahren. Dies erschwert für bundesweit tätige Mandant:innen eine strategisch einheitliche Prozessführung in solchen Massenverfahren und erschwert die Kalkulierbarkeit gerichtlicher Auseinandersetzungen.
3. Verfahrensrecht im Wandel – mehr Struktur, weniger Verzögerung
Mit der „Übersetzung“ der Verfahrensordnungen in das digitale Zeitalter beabsichtigt die Bundesregierung eine grundlegende Modernisierung des Prozessrechts. Digitale Verfahrensplattformen sollen klassische Papierakten ersetzen, elektronische Beweismittel umfassend zugelassen werden. Dadurch sollen Verfahren beschleunigt und transparenter gestaltet werden.
Ein weiteres Ziel der Reformen ist die Verkürzung der Verfahrensdauern. Um dies zu erreichen, sollen auch die Zugangsmöglichkeiten zu zweiten Tatsacheninstanzen durch Anhebung der Rechtsmittelstreitwerte begrenzt werden. Zudem werden die Präklusionsfristen – also Fristen für das Vorbringen von Angriffs- und Verteidigungsmitteln – ausgeweitet. Ferner sollen Verfahrenslaufzeiten durch strukturelle Maßnahmen reduziert werden: Geplant ist eine Stärkung richterlicher Verfahrensleitung, insbesondere durch frühzeitige Verfahrenskonferenzen und Vorgaben zur Strukturierung des Parteivortrags.
Für Mandant:innen führt dies einerseits zu schnelleren und planbareren Verfahren, da die Fristen und Struktur klar definiert sind. Dies ermöglicht eine frühzeitige Einschätzung der Erfolgsaussichten und der nächsten Schritte im Verfahren. Andererseits wird der Druck auf die Parteien erhöht, ihre Verteidigungsmittel frühzeitig vorzubringen, da eine nachträgliche Ergänzung immer schwieriger wird. Insbesondere in komplexen Verfahren ist daher eine sorgfältige und umfassende Vorbereitung unerlässlich, um prozessuale Nachteile durch formale Ausschlussregelungen oder verfahrensbedingte Beschränkungen zu vermeiden. Auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Justiz könnte neue rechtliche Fragestellungen aufwerfen, die eine enge rechtliche Beratung erforderlich machen. Sollte es zur Anhebung der Rechtsmittelstreitwerte kommen, wären Entscheidungen über Streitigkeiten mit geringerem Streitwert künftig teilweise nicht mehr mit einem Rechtsmittel angreifbar. Mandant:innen wären in solchen Fällen auf die Entscheidung des Amtsgerichts beschränkt, selbst wenn dieser rechtsfehlerhaft ist – ein Umstand, der die Rechtsschutzmöglichkeiten spürbar einschränkt.
Wie konkret diese vorgesehenen Änderungen umgesetzt werden und zu einer modernisierten Justiz mit einem Fokus auf Digitalisierung, Effizienz und eine strukturierte Prozessführung führt, bleib offen. Eine Trendwende weg von Individualklagen lässt sich bislang nicht prognostizieren. Das Potenzial für Massenverfahren ist aufgrund der voranschreitenden Technisierung und der fortschreitenden Europäisierung der Rechtsdurchsetzung nicht von der Hand zu weisen. Greenwashing-Vorwürfe oder sonstige ESG-Themen könnten möglicherweise einen Nährboden für Massenverfahren darstellen, weshalb Massenverfahren – obgleich der geplanten Änderungen – in signifikantem Umfang weiter zunehmen könnten. Daher werden teils noch weitergehende, nicht unumstrittene Eingriffe in das Verfahrensrecht gefordert. Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber die ausgeworfenen Ziele konkret umsetzt, um auch dem Phänomen Massenverfahren entgegenzuwirken.
Wir informieren Sie in unserer Blog-Serie zum Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD fortlaufend mit aktuellen Beiträgen zu diesem Thema. Sie können diese Blog-Serie über den RSS-Feed abonnieren und werden von uns über neue Beiträge informiert.
