Die Bundesregierung macht ernst mit KI: Deutschland soll zur „KI-Nation“ aufsteigen.
Der neue Koalitionsvertrag 2025 rückt Künstliche Intelligenz ins Zentrum der Innovations- und Wirtschaftspolitik. Was jetzt auf Unternehmen zukommt – und wie sie sich strategisch richtig aufstellen.
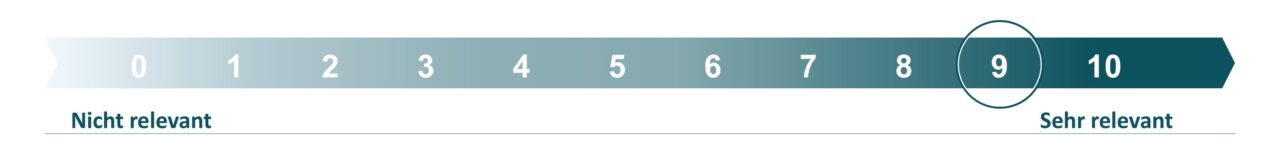
Strategiewechsel: KI als wirtschaftspolitisches Kernprojekt
Die neue Bundesregierung stellt Künstliche Intelligenz ins Zentrum ihrer wirtschafts- und technologiepolitischen Strategie. Laut Koalitionsvertrag 2025 soll Deutschland durch gezielte Infrastrukturinvestitionen, innovationsfreundliche Regulierung und eine enge Kooperation zwischen Staat, Wirtschaft und Wissenschaft zur führenden KI-Nation Europas aufsteigen.
Neu ist dabei die Tiefe des im Koalitionsvertrag gewählten Ansatzes. Künstliche Intelligenz wird nicht mehr nur als Zukunftstechnologie betrachtet, sondern als Querschnittsmaterie, die wichtige Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenlebens entscheidend verändern wird. Die im Koalitionsvertrag festgelegte KI-Agenda ist damit weit mehr als ein digitales Leuchtturmprojekt – sie soll strukturelle Modernisierung und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Kontext sichern.
Gigafactorys, Reallabore, Regulierung: Das ist konkret geplant
Die Koalition plant – so wörtlich – „massive Investitionen“ in die digitale Infrastruktur und den Ausbau von KI-Kapazitäten. Zentrale Maßnahmen im Überblick:
- Errichtung einer nationalen KI-Gigafactory: Ein Pool mit mindestens 100.000 Grafikprozessoren soll eingerichtet werden, um Forschungseinrichtungen und Hochschulen den Zugang zu Hochleistungsrechenzentren zu ermöglichen.
- Aufbau von KI-Reallaboren: Deutschland soll ein Spitzenstandort für digitale Zukunftstechnologien werden. Zu diesem Zweck sollen KI-Reallabore eingerichtet werden, wo innovative KI-Anwendungen unter realen Bedingungen erprobt werden können. Ziel ist es, hierdurch insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei der KI-Entwicklung zu unterstützen.
- Innovationsfreundliche Umsetzung des AI Acts: Ein Ziel der neuen Bundesregierung ist es, Belastungen für die Wirtschaft, welche durch die regulatorischen Anforderungen des AI Acts hervorgerufen werden, abzubauen. Der AI Act soll in Deutschland innovationsfreundlich und bürokratiearm umgesetzt werden und eine Zersplitterung der nationalen Marktaufsicht verhindert werden.
- KI in der öffentlichen Verwaltung und Justiz: Die Bundesregierung plant, KI verstärkt in der Verwaltung einzusetzen und damit Verwaltungsprozesse zu beschleunigen, zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Auch soll Künstliche Intelligenz in größerem Umfang in der Justiz Einzug halten.
- Kultur & KI: Die Bundesregierung plant eine Bundesländer-übergreifende Strategie, welche einerseits das große kulturwirtschaftliche Potenzial von KI ausnutzt, zum anderen aber Urheberrechte schützen und künstlich generierte Inhalte stets als solche kenntlich machen soll.
Nationale KI-Agenda im Einklang mit Brüssel
Die KI-Strategie der Bundesregierung steht in enger Verbindung mit den Maßnahmen der Europäischen Kommission. Viele der im Koalitionsvertrag angelegten Initiativen – etwa der Aufbau von KI-Gigafactories, Investitionen in Rechenkapazitäten oder die Schaffung von Reallaboren – finden sich nahezu deckungsgleich in den EU-Strategien wie dem am 9. April 2025 veröffentlichte „AI Continent Action Plan“ wieder. Die Bundesregierung orientiert sich damit klar an den europäischen Leitlinien – was Unternehmen sowohl rechtliche Kohärenz als auch potenziell zusätzlichen Zugang zu Fördermitteln bietet.
KI und Recht: Wachsende Anforderungen an Unternehmen – auch jenseits des AI Act
Mit dem Koalitionsvertrag kommen auf Unternehmen nicht nur technologische Chancen, sondern auch neue rechtliche Herausforderungen zu. Besonders komplex gestaltet sich die Umsetzung des AI Acts. Unternehmen müssen künftig genau bestimmen, welche KI-Systeme sie zu welchen Zwecken einsetzen und welcher der im AI Act geregelten Risikoklassen die KI-Systeme unterfallen. Für sogenannte Hochrisiko-Systeme gelten dabei strenge Anforderungen an Transparenz, Datenqualität und Risikobewertung. Erst nach Durchführung eines Konformitätsbewertungsverfahrens dürfen solche KI-Systeme in der EU in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden.
Einen weiteren rechtlichen Brennpunkt stellt der Datenschutz dar: Die Bundesregierung setzt zwar auf Innovationsoffenheit, gleichzeitig bestehen zwischen dem Datenschutz und dem KI-Einsatz, insbesondere in sensiblen Bereichen wie dem Personalwesen oder im Gesundheitssektor, erhebliche Spannungen. Unternehmen werden daher bereits im Vorfeld jedes KI-Einsatzes datenschutzrechtliche Prüfungen vornehmen müssen, um einen datenschutzkonformen Einsatz der KI-Systeme zu gewährleisten.
Zentral ist dabei auch die Schulung der Mitarbeitenden in Organisationen, die KI-Systeme einsetzen. Organisationen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden über die notwendige KI-Kompetenz verfügen, was unter anderem auch Grundkenntnisse über wichtige rechtliche Themen im Zusammenhang mit KI umfasst, wie etwa den Datenschutz.
Hinzukommt, dass auch die Marktaufsicht deutlich aktiver werden dürfte. In Verhandlungsrunden wurden bereits Bedenken laut, dass gerade mittelständische Anbieter durch überkomplexe Anforderungen benachteiligt werden könnten. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass durch parallele Regelungsebenen auf EU- und Bundesebene ein schwer kalkulierbarer Regulierungsrahmen entsteht. Die eigentliche Herausforderung liegt daher weniger in der Zielsetzung der Regulierung, sondern vielmehr in ihrer praktischen Umsetzbarkeit – insbesondere angesichts der Mehrgleisigkeit von EU- und Bundesrecht.
Was Unternehmen jetzt tun sollten
Der Kurs der Bundesregierung ist klar: Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren stark reguliert, aber ebenso stark gefördert. Unternehmen sollten diesen Wandel aktiv mitgestalten – strategisch, rechtlich und technologisch.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eigene KI-Roadmaps zu entwickeln: Wo bestehen Potenziale? Welche Anwendungen sind realistisch? Welche Partner – intern wie extern – sind notwendig? Parallel dazu sollten die internen Strukturen fit gemacht werden für neue Compliance-Anforderungen – von der Risikoanalyse über Datenschutzkonzepte bis hin zur Einrichtung einer internen Anlaufstelle für KI-Themen.
Ein drittes Handlungsfeld betrifft die Förderlandschaft. Die angekündigten Programme zu Rechenkapazitäten, Pilotprojekten oder Weiterbildungen werden schnell ausgeschöpft sein. Frühzeitiges Handeln kann hier entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern. Und nicht zuletzt lohnt sich der Blick in die entstehenden Reallabore: Sie ermöglichen es, neue KI-Lösungen unter realen Bedingungen zu erproben.
KI endgültig als zentrale Schlüsseltechnologie anerkannt
Die neue Bundesregierung erkennt Künstliche Intelligenz nicht nur als Zukunftstechnologie an, sondern verankert sie klar und sichtbar als zentrales Handlungsfeld im Koalitionsvertrag 2025. Mit gezielten Fördermaßnahmen – wie dem Aufbau einer nationalen KI-Gigafactory oder der Einrichtung von Reallaboren – wird der Weg für eine moderne und innovationsgetriebene Entwicklung geebnet. Zusätzlich soll die verstärkte Förderung von Start-ups und Innovationen Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiver und wettbewerbsfähiger machen. Gelingt die Umsetzung dieser Vorhaben, steht Deutschland eine vielversprechende und zukunftsorientierte Entwicklung
Wir informieren Sie in unserer Blog-Serie zum Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD fortlaufend mit aktuellen Beiträgen zu diesem Thema. Sie können diese Blog-Serie über den RSS-Feed abonnieren und werden von uns über neue Beiträge informiert.
