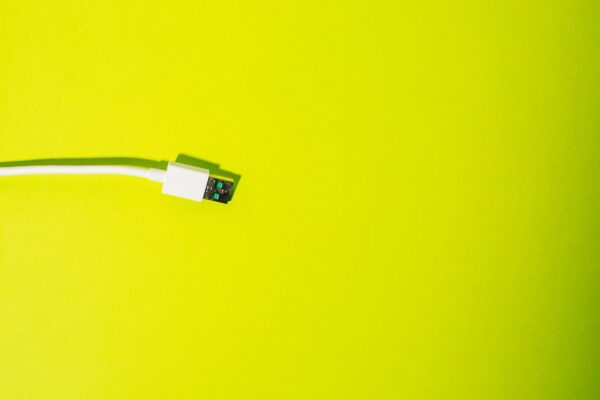Am 11. September 2025 hat die Europäische Kommission den Entwurf einer neuen Technologietransfer-Gruppenfreistellung (TT-GVO) und den Entwurf neuer Technologietransfer-Leitlinien (TT-Leitlinien) veröffentlicht.
Die aktuelle Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Europäischen Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO) läuft Ende April 2026 aus. Die Europäische Kommission hatte vor einiger Zeit ein Evaluierungs- und Konsultationsverfahren eingeleitet, um Erkenntnisse über den praktischen Nutzen der TT-GVO und der von der Europäischen Kommission hierzu erlassenen Leitlinien (TT-Leitlinien) zu sammeln. Wir hatten über hierüber mehrfach berichtet.
Am 11. September 2025 hat die Europäische Kommission nun endlich den Entwurf für eine neue TT-GVO und den Entwurf für neue TT-Leitlinien veröffentlicht und die interessierten Kreise zur Stellungnahme aufgefordert.
Worum geht es bei TT-GVO und TT-LL?
Die TT-GVO ist eine Gruppenfreistellung der Europäischen Kommission, mit der sie wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen über den Technologietransfer unter bestimmten Voraussetzungen von dem Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach Art. 101 Abs. 1 AEUV ausnimmt.
Der Sinn dahinter liegt darin, dass Technologietransfer-Vereinbarungen häufig die Verbreitung von Technologie fördern und Anreize für Forschung und Entwicklung schaffen und somit regelmäßig wettbewerbsfördernd sind. Dies gilt selbst dann, wenn sie wettbewerbsbeschränkende Wirkungen haben oder Klauseln mit wettbewerbsbeschränkender Wirkung enthalten. Ganz gravierende Wettbewerbsbeschränkungen sollen jedoch nicht zugelassen sein.
Typische Anwendungsfälle von Technologietransfer-Vereinbarungen sind Patentlizenzverträge, mit denen Patentinhaber bzw. Lizenzgeber den Lizenznehmern die Herstellung eines patentierten Produktes oder die Anwendung eines patentierten Verfahrens ermöglichen. Eine typische Beschränkung mit möglicherweise wettbewerbsbeschränkender Auswirkung wäre in diesem Beispiel eine Beschränkung des Gebiets, in dem der Lizenznehmer die patentierten Produkte verkaufen darf, oder eine Beschränkung der Bestimmung des Preises für den Verkauf an Dritte. Neben Patenten können auch Know-how oder andere geistige Eigentumsrechte (z.B. Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Sortenschutzrechte, Software-Urheberrechte, etc.) Gegenstand eines Technologietransfer-Vertrages sein.
Die Regelungen der TT-GVO weisen einen hohen Abstraktionsgrad auf, um die vielfältigen Ausgestaltungen von Technologietransfer-Verträgen zu erfassen. Als Hilfe für den Rechtsanwender hatte die Europäische Kommission die TT-Leitlinien mit näheren Erläuterungen zu der kartellrechtlichen Prüfung von Technologietransfer-Verträgen erlassen.
Klarstellungen zu den Marktanteilsschwellen der TT-GVO
Wie erwartet, sollen die Marktanteilsschwellen nicht geändert werden. Die Europäische Kommission kommt allerdings dem Wunsch nach Klarstellungen und Präzisierungen nach.
So möchte die Europäische Kommission die „sunset clause“ der TT-GVO anpassen und den Übergangszeitraum für die Geltung der Freistellung, wenn die Marktanteile der Parteien erst während der Laufzeit der Vereinbarung die relevanten Schwellenwerte übersteigen, von zwei auf drei Jahre verlängern. Das dient der Verbesserung der Rechtssicherheit und Planbarkeit für die Unternehmen.
Die in den Erwägungsgründen der TT-GVO vorgenommene Klarstellung soll die Unsicherheiten bei der Berechnung der Marktanteile reduzieren. Demnach soll bei der Berechnung der Marktanteile gelten, dass auf Technologiemärkten, auf denen es noch keine Verkäufe von Vertragsprodukten gab, von einem Marktanteil von Null ausgegangen werden. Die Änderung wird nur deklaratorisch sein. Dies stand bisher in den TT-Leitlinien (Rn. 90) und wird auch weiterhin dort zu finden sein (in Rn. 112). Es handelt sich letztlich nur um ein „Upgrade“, was die Verbindlichkeit angeht.
Weitere kleinere Klarstellungen finden sich in der Vorschrift über die Anwendung der Marktanteilsschwellen (sowie in den TT-Leitlinien
Anpassung der Hinweise zu Technologiepools in den TT-Leitlinien
In der aktuellen TT-GVO wie auch im jetzt vorliegenden Entwurf für eine neue TT-GVO finden sich keine Regelungen zu Technologiepools. Mit Technologiepools ist gemeint, dass Inhaber von Technologierechten wie z.B. Patenten gemeinsam Lizenzen erteilen. Der Grund für die Nichtaufnahme in die TT-GVO ist, dass ihnen keine von nur zwei Unternehmen (also bilateral) geschlossenen Verträge zugrunde liegen, die TT-GVO aber nur auf bilaterale Verträge anwendbar ist. Eine Aufnahme multilateraler Verträge in die TT-GVO lehnt die Europäische Kommission weiterhin ab. Sie entspricht immerhin dem Wunsch der Praxis nach mehr „Guidance“ und möchte den in den TT-Leitlinien definierten sog. „weichen sicheren Hafen“ anpassen.
„Sicherer Hafen“ bedeutet in diesem Kontext, dass Unternehmen sich durch ihr Verhalten in der Regel keinen kartellrechtlichen Bedenken aussetzen, soweit sie die Anforderungen des „sicheren Hafens“, hier mit der Ausgestaltung ihres Technologiepools, einhalten. „Weich“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es nicht auf quantitative Voraussetzungen wie insbesondere Marktanteile ankommt, sondern bloß auf qualitative.
Die vorgeschlagenen Anpassungen des „sicheren Hafens“ zielen auf die Herstellung von Transparenz (durch eine Offenlegung der enthaltenen Technologierechte), sog. „Essenzialität“, also dass nur essenzielle Technologien in dem Pool zusammengeführt werden (und keine ersetzbaren), und Vermeidung von doppelten Lizenzgebühren für ein und dasselbe Technologierecht.
Aufnahme des Themas „LNG“ in die TT-Leitlinien
Die Europäische Kommission möchte dem in der Evaluierung und Konsultation geäußerten Wunsch entsprechen, das Thema „LNG“ künftig zu behandeln, wenn auch nicht in der TT-GVO selbst, so doch in den TT-Leitlinien.
Hinter der Abkürzung LNG verbirgt sich der Begriff der „Licensing Negotation Group“ oder – auf (kommissions)deutsch – Lizenzverhandlungsgruppe.
Lizenzverhandlungsgruppen sind potenzielle Lizenznehmer, die gemeinsam Lizenzbedingungen mit dem Lizenzgeber aushandeln. Die Befürworter sehen darin eine Möglichkeit, durch die Bündelung den Zugang zu wichtigen Technologien erleichtern. Für die Gegner handelt es sich um Einkaufskartelle. Die Wahrheit dürfte, wie so häufig, gerade auch im Kartellrecht, in der Mitte liegen. Und deswegen sieht die Europäische Kommission auch Handlungsbedarf, dem sie entsprechen möchte.
Sie macht dies durch Aufnahme eines ganzen neuen Kapitels in die TT-Leitlinien und Definition eines „weichen sicheren Hafens“, mit einem quantitativen Unterkriterium. Zusammengefasst hat der sichere Hafen folgende – zum Teil wenig überraschende – Voraussetzungen:
- Offener Zugang zur LNG
- Offenes Auftreten der LNG gegenüber dem Lizenzgeber
- Beschränkung der LNG auf das Aushandeln der Lizenzbedingungen
- Beschränkung des Informationsaustausches in der LNG auf das zwingend Erforderliche
- Kein kollektiver Boykott
- Keine Exklusivität und Vorgaben für die Lizenzvergabe durch den Lizenzgeber an Dritte
- Begrenzung der Lizenzgebühren auf maximal 10% des Verkaufspreises der Produkte, die die lizenzierte Technologie enthalten.
Außerhalb des sicheren Hafens bleibt eine Anwendung der allgemeinen Freistellungsvorschrift möglich und die Europäische Kommission gibt Hinweise hierfür.
Und was ist mit Datenlizenzen?
Das Wichtigste vorneweg: Die neue TT-GVO soll nach den Vorstellungen der Europäischen Kommission keine Regelungen zu Datenlizenzen enthalten. Insoweit bleibt es bei dem bisherigen Stand der Dinge. Die Europäische Kommission greift jedoch die Erkenntnisse aus der Konsultation und eines Gutachtens auf und möchte das Thema der Datenlizenzen in den neuen TT-Leitlinien behandeln, und zwar in einem eigenen Unterabschnitt in dem Kapitel zu den Technologierechten.
Im Entwurf hält sie fest, dass sie die in der TT-GVO und in den TT-Leitlinien entwickelten Grundsätze „in der Regel“ auch auf die Lizenzierung von Daten anwenden wird, soweit diese Daten in einer Datenbank enthalten sind, die entweder urheberrechtlich oder durch das in der Datenbankrichtlinie festgelegte Schutzrecht geschützt ist. Jenseits dessen hat eine Prüfung im Einzelfall zu erfolgen, ob Grundsätze der TT-GVO auf Datenlizenzen angewendet werden können.
Neue TT-GVO: Evolution statt Revolution
Die Europäische Kommission hat sich die Mühe gemacht, die vorstehenden geplanten Änderungen und weitere kleinere Anpassungen an TT-GVO und TT-Leitlinien sie in einem Papier zusammenzufassen.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Europäische Kommission keine tiefgreifenden Änderungen vornehmen möchte und im Grundsatz an dem Inhalt der TT-GVO festhalten möchte. Unsere früheren Vorhersagen zur TT-GVO bzw. der Überarbeitung haben sich – mehr oder weniger – bewahrheitet.
Es bleibt abzuwarten, welche Hinweise für die Europäische Kommission sich aus der mit der Veröffentlichung der Entwürfe von TT-GVO und TT-Leitlinien gestarteten Konsultation noch ergeben. Die Frist für die Einreichung von Stellungnahmen endet am 25. Oktober 2025.
Unser Blick in die Kristallkugel sagt uns, dass die künftige TT-GVO und die TT-Leitlinien nicht wesentlich von den jetzt vorgelegten Entwürfen abweichen werden. Damit wird eine neue TT-GVO ihrer aktuell noch geltenden Vorgängerin recht ähnlich sehen. Die Europäischen Kommission setzt bei der TT-GVO auf – behutsame – Evolution und nicht Revolution.
Ganz genau werden wir es erst im Frühjahr 2026 wissen, wenn die Europäische Kommission rechtzeitig vor Auslaufen der aktuellen TT-GVO am 30. April 2026 eine neue beschlossen und im Amtsblatt veröffentlicht hat.