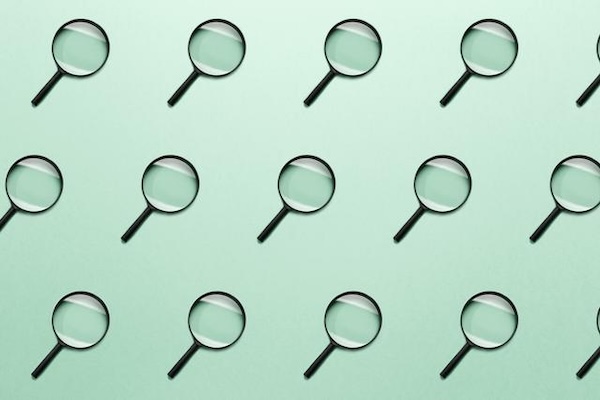Einsatz von KI bei der Kartellverfolgung und neue Entwicklungen in der Digitalwirtschaft – im deutschen Kartellrecht hat sich 2024 einiges getan.
Das neue Jahr 2025 ist nur wenige Wochen alt. Ein guter Zeitpunkt, um das vergangene Jahr 2024 Revue passieren zu lassen. Ein Rückblick auf die Entwicklungen im Kartellrecht lohnt sich dabei ganz besonders. In Zeiten, in denen sich KI immer mehr in unser alltägliches Leben schleicht und die Digitalwirtschaft stetig an Bedeutung gewinnt, besteht Anpassungsbedarf der Kartellbehörden. Ein Blick auf die Bereiche Missbrauchsaufsicht, Kartellverfolgung, Digitalwirtschaft und Fusionskontrolle zeigt, dass das Bundeskartellamt wachsam ist und mit der Zeit geht – und erlaubt uns auch den ein oder anderen Ausblick auf das Jahr 2025:
Missbrauchsaufsicht
Mit der besonders starken Marktposition eines Unternehmens geht aus Sicht des Kartellrechts auch eine besondere Marktverantwortung einher. Im vergangenen Jahr hat das Bundeskartellamt dabei mehrere Branchen im Blick gehabt:
- Das Bundeskartellamt hat 2024 einige Verfahren gegen Fernwärmeversorger eingeleitet. Die Befürchtung: eine unangemessene Preisgestaltung zulasten der Verbraucher. Dies soll nun überprüft werden.
- Auch im Lebensmittelbereich hat das Bundeskartellamt seine Augen und Ohren offen gehalten und eine Überprüfung der Konditionen von Herstellern gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel wie auch die Verhaltensweisen von großen Händlern eingeleitet.
- Weitere 13 Verfahren hat das Bundeskartellamt gegen Energielieferanten im Bereich Preisbremsen eingeleitet. Seit Mai 2023 hat es damit insgesamt 70 Prüfverfahren eingeleitet, 33 davon betreffen den Bereich Erdgas, 17 den Bereich Wärme und 20 den Bereich Elektrizität. Durch die Missbrauchsaufsicht soll nach Vorstellung des Gesetzgebers gewährleistet werden, dass Unternehmen im Rahmen der Energiepreisbremsen die Entlastungsbeträge nicht zu Unrecht einfordern.
Im Jahr 2025 wird zu erwarten sein, dass das Bundeskartellamt den Stromerzeugungsmarkt besonders unter die Lupe nehmen wird. Das Bundeskartellamt hat angekündigt, 2025 die Preisbildung während der Dunkelflaute, die durch extreme Ausschläge auffiel, genau anzusehen und sicherzustellen, dass diese nicht das Ergebnis missbräuchlichen Verhaltens war.
Kartellverfolgung
Auch im Jahr 2024 hatte die Kartellverfolgung für das Bundeskartellamt wieder hohe Priorität:
- Unangekündigte Durchsuchungen des Bundeskartellamts, sogenannte „Dawn Raids“, bleiben aus Sicht der Behörde das Mittel der Wahl bei der Kartellbekämpfung. Insgesamt elf Durchsuchungen hat das Bundeskartellamt im Jahr 2024 ausgeführt, davon drei im Wege der Amtshilfe. Im Jahr 2023 waren es ebenfalls elf Durchsuchungen, im Jahr 2022 ganze 18. Unternehmen sind daher gut darin beraten, sich auf unangekündigte Durchsuchungen durch die Kartellbehörden einzustellen und bereits im Vorfeld Maßnahmen zu treffen, die ein Fehlverhalten im Ernstfall vermeiden.
- Bei der Kartellverfolgung ist die Kronzeugenregelung des Bundeskartellamts seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken. Insgesamt 17 Unternehmen stellten im vergangenen Jahr Kronzeugenanträge bei dem Bundeskartellamt. Auch wenn die Kronzeugenregelung nach wie vor ein von den Kartellbehörden sehr geschätztes Mittel in der Kartellverfolgung darstellt, geht die überwiegende Zahl der aktuell geführten Kartellbußgeldverfahren mittlerweile offenbar auf Quellen zurück, die außerhalb des Kronzeugenprogramms liegen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei nach Aussage des Bundeskartellamts die Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), die das Bundeskartellamt seit Juli 2023 betreibt.
- Der technische Fortschritt erleichtert nicht nur uns immer mehr das alltägliche Leben, sondern dem Bundeskartellamt auch die Kartellverfolgung. So setzt das Amt bei der Aufdeckung von Kartellen nach eigenem Bekunden seit 2024 Software-gestütztes Markt-Screening ein, um kartellrechtswidrige Absprachen aufzuspüren. Darüber hinaus gab Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamts, bekannt, bei der Aufdeckung von Kartellen zunehmend KI einsetzen zu wollen. Hierauf darf man gespannt sein.
- Auch im Jahr 2024 hat das Bundeskartellamt die festgestellten Kartellrechtsverstöße sanktioniert. Es hat im Jahr 2024 Geldbußen in Höhe von insgesamt ca. EUR 19,4 Mio. verhängt. Davon betroffen waren insgesamt drei Unternehmen und eine natürliche Person. Kartellrechtsverstöße können mit einem Bußgeld in Höhe von maximal zehn Prozent des weltweiten Konzernumsatzes sanktioniert werden. Bußgelder gegen kartellbeteiligte Privatpersonen werden abhängig von der Schwere der Tat und Besonderheiten der Täterin oder des Täters mit einer Höhe von maximal EUR 1 Mio. festgesetzt.
Ein Blick zurück auf die vorherigen Jahre lässt insgesamt allerdings einen Rückgang der festgestellten Kartellrechtsverstöße erkennen. Ob das den neu eingeführten Instrumenten wie die Eingriffsmöglichkeiten nach Sektoruntersuchungen zu verdanken ist, mit denen das Bundeskartellamt durch die 11. GWB-Novelle ausgestattet wurde? So lautet zumindest die Vermutung, die ein Vertreter des Bundeskartellamts im Sommer 2024 preisgab. Die wahrscheinlichere Erklärung dürfte doch aber in den Compliance-Bemühungen der Unternehmen liegen.
Digitalwirtschaft
Wie auch in den vergangenen Jahren galt 2024 die Aufmerksamkeit des Bundeskartellamts in besonderem Maße der Digitalwirtschaft:
- Das gerichtliche Verfahren des Bundeskartellamts gegen einen US-amerikanischen Internetkonzern und Betreiber diverser sozialer Plattformen fand im vergangenen Jahr nach jahrelanger Verfahrensdauer seinen Abschluss. Die ergangene Entscheidung untersagt es dem Internetkonzern, personenbezogene Daten der Nutzenden diverser sozialen Plattformen ohne freiwillige Einwilligung zusammenzuführen.
- Das Bundeskartellamt war im Rahmen der erweiterten Missbrauchsaufsicht gegen große Digitalkonzerne 2024 weiterhin aktiv. Nach § 19a GWB kann das Bundeskartellamt durch Verfügung feststellen, dass einem Digitalkonzern eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt, und auf dieser Grundlage wettbewerbsgefährdende Praktiken dieser Unternehmen untersagen. Die noch laufenden Verfahren hat das Bundeskartellamt 2024 weiter fortgeführt.
Der Bereich der Digitalwirtschaft dürfte auch 2025 besonders spannend bleiben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass derzeit einige Verfahren gegen die weltweit größten IT-Unternehmen laufen, die sogenannten „Big Tech“. Von großer Bedeutung ist hierbei für das Bundeskartellamt das Thema KI. Das Bundeskartellamt befürchtet hier drohende Abhängigkeiten. Andreas Mundt selbst verkündete jüngst: „Die Digitalwirtschaft bleibt ganz oben auf unserer Agenda.“
Fusionskontrolle
In der Fusionskontrolle lässt sich seit einigen Jahren eine rückläufige Tendenz der Anmeldung von Zusammenschlussvorhaben bei dem Bundeskartellamt feststellen. Im Jahr 2023 gingen insgesamt 804 fusionskontrollrechtliche Anmeldungen bei dem Bundeskartellamt ein. 2024 ließen sich ca. 900 Fusionskontrollanmeldungen verzeichnen, sodass sich zum Vorjahr nur ein leichter Anstieg an Fusionskontrollverfahren erkennen lässt. In insgesamt zehn dieser 900 Fusionskontrollverfahren wollte das Amt die beabsichtigten Zusammenschlüsse genauer unter die Lupe nehmen und leitete das Hauptprüfverfahren ein. Während zwei dieser Hauptprüfverfahren derzeit noch andauern, endeten drei mit der Freigabe des Bundeskartellamts, wie z.B. die Übernahme von Olink durch Thermo Fisher Scientific und in weiteren vier wurde das Vorhaben wegen kartellrechtlicher Bedenken jeweils aufgegeben und die fusionskontrollrechtliche Anmeldung zurückgenommen. Lediglich die angemeldete Übernahme des Universitätsklinikums Mannheim durch das Universitätsklinikum Heidelberg untersagte das Bundeskartellamt.
Die Fusionskontrolle ist und bleibt ein wichtiges Instrument des Bundeskartellamts, um Marktmacht präventiv zu unterbinden – ein Instrument, das sich den Entwicklungen der Wirtschaft anpasst. Die mit der 9. GWB-Novelle eingeführte Transaktionswertschwelle erlangt zunehmend an Bedeutung. Diese ermöglicht dem Bundeskartellamt die Überprüfung wichtiger Zusammenschlussvorhaben, die zwar nicht die Umsatzschwellen der deutschen Fusionskontrolle erreichen, bei denen der Erwerber jedoch bereit ist, wegen der hohen wirtschaftlichen Bedeutung des Zielunternehmens einen entsprechend hohen Kaufpreis (über EUR 400 Mio.) zu bezahlen. Sogenannte „Killer Acquisitions“, wenn es sie tatsächlich gibt, können von dem Bundeskartellamt hierdurch im Auge behalten werden. Unter „Killer Acquisitions“ versteht man die Übernahme sehr forschungsstarker Unternehmen, die auf neuartigen Wachstumsmärkten tätig sind, meist mit dem Ziel, diese Unternehmen bzw. die von ihnen angebotenen Technologien vom Markt zu nehmen. Es ist zu erwarten, dass die Bedeutung der Transaktionswertschwelle stetig zunehmen wird, insbesondere bei der Übernahme innovativer KI-Startups.
„Killer Acquisitions“ ist auch das Schlagwort für die derzeitigen Debatte zu sogenannten „Call-in“-Rechten der nationalen Kartellbehörden der EU-Mitgliedstaaten. Das Bundeskartellamt scheint in diesem Punkt zurecht eher skeptisch. Ein „Call-in“-Recht ermöglicht einer Kartellbehörde, auch solche Zusammenschlüsse zu überprüfen und einer fusionskontrollrechtlichen Anmeldepflicht zu unterziehen, selbst wenn ein Zusammenschluss unterhalb der Anmeldeschwellen des jeweiligen EU-Mitgliedstaats liegt. In der EU sind nach der jüngsten Entscheidung des Europäischen Gerichtshof in Sachen Illumina/Grail vom 03. September 2024 solche „Call-in“-Rechte von ganz besonderer Bedeutung: Artikel 22 der EU-Fusionskontrollverordnung, der die Verweisungsmöglichkeit von Zusammenschlüssen durch die EU-Mitgliedstaaten an die Europäische Kommission vorsieht, soll nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nunmehr nur noch anwendbar sein, wenn der verweisende EU-Mitgliedstaat auch tatsächlich zuständig ist. Eine solche Prüfungskompetenz der EU-Mitgliedstaaten ließe sich bei Vorliegen eines „Call-in“-Rechts annehmen. Die Fusionskontrollregimes in Dänemark, Irland, Italien, Lettland, Litauen Schweden, Slowenien, Ungarn und Zypern sehen solche „Call-in“-Rechte bereits vor. Weitere EU-Mitgliedstaaten wie Griechenland, die Niederlande und Tschechien denken über eine Einführung nach. Für die Transaktionssicherheit sind solche Aufgreifmöglichkeiten nicht gut.