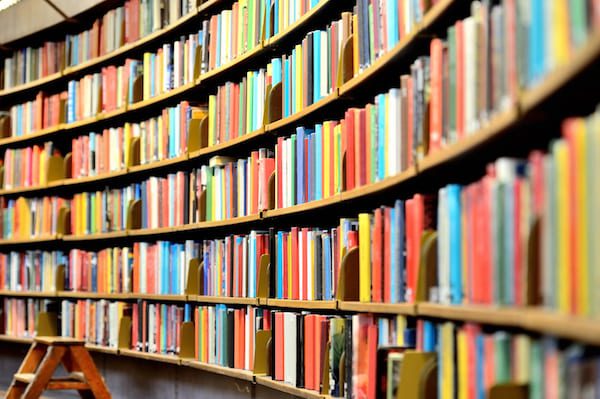Nach dem BGH dürfen die durch die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) erzielten Einnahmen nicht pauschal zur Hälfte an die Verlage ausbezahlt werden.
Die Einnahmen aus der Kopiervergütung waren von der VG Wort bislang pauschal jeweils zur Hälfte an die Autoren und zur Hälfte an die Verlage auskehrt worden. Dies war nicht unumstritten.
Nun hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs am 21. April 2016 das mit Spannung erwartete Grundsatzurteil in dem Verfahren zwischen einem Autor und der VG Wort verkündet (BGH, Az. I ZR 198/13). Danach ist die derzeitige Ausschüttungspraxis der VG Wort nicht rechtmäßig. Das Urteil läutet das Ende einer jahrzehntelangen Vergütungspraxis ein.
Die Abkehr vom gewohnten Modell wird erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Vor allem für die Verlage, aber auch für die Autoren in der Zusammenarbeit mit den Verlegern.
Bestimmte Vergütungsansprüche von Urhebern sind gesetzlich festgelegt
Autoren müssen aufgrund gesetzlicher Schranken des Urheberrechts das Anfertigen von Privatkopien ihrer Werke grundsätzlich dulden. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber zum Ausgleich einen pauschalen Vergütungsanspruch der Urheber für die Nutzung ihrer Werke durch Privatkopien vorgesehen. Diesen gesetzlich statuierten Vergütungsanspruch müssen die Hersteller von Kopiergeräten durch Abgaben an die Verwertungsgesellschaften erfüllen (sog. Geräteabgabe).
Rechtliche Grundlage für die bisherige Praxis der Verwertungsgesellschaften zur Verteilung der Einnahmen aus der Geräteabgabe ist § 63a S. 2 UrhG. Danach können Urheber ihre gesetzlichen Vergütungsansprüche an ihren Verleger abtreten. Als Voraussetzung muss der Verleger die Ansprüche durch eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen lassen, die die Rechte von Verlegern und Urhebern gemeinsam wahrnimmt (sog. zweckgebundene Abtretung). Die Vereinbarkeit dieser Regelung mit EU-Recht steht nun in Frage.
Vorgeschichte des Verfahrens Vogel / VG Wort
Beklagte in dem BGH-Verfahren ist die VG Wort, die als einzige Verwertungsgesellschaft in Deutschland die ihr vertraglich anvertrauten Rechte und Ansprüche von Wortautoren und deren Verlegern wahrnimmt.
Der Kläger ist Autor wissenschaftlicher Werke. Er hat mit der VG Wort einen Wahrnehmungsvertrag geschlossen, in dem er der VG die Wahrnehmung seiner gesetzlichen Vergütungsansprüche übertragen hat. In seiner Klage wendet sich der Autor dagegen, dass die VG Wort die Verleger gemäß ihrem Verteilungsplan pauschal an den Einnahmen aus der Geräteabgabe mit einem hälftigen Anteil beteiligt und damit seinen Autorenanteil an diesen Einnahmen schmälert.
Die Vorinstanzen (LG München I, Az. 7 O 28640/11 u. OLG München, Az. 6 U 2492/12) gaben der Klage weitgehend statt. Sie begründeten ihre Auffassung damit, dass der Kläger seine Rechte bereits vollständig an die VG abgetreten habe. Eine Beteiligung der Verlage sei zwar grundsätzlich möglich, aber nur dann, wenn diese auch tatsächlich die Vergütungsansprüche der Autoren durch wirksame Abtretung eingeräumt bekommen hätten. Seien die Ansprüche bereits an die VG abgetreten worden, könnten sie nicht nochmals an den Verlag abgetreten werden. Eine solche spätere Abtretung sei aufgrund des Prioritätsgrundsatzes unwirksam. Wenn dem Verlag somit keine abgeleiteten Rechte zustünden, stünde ihm auch kein Anteil an der Vergütung zu.
Aussetzung des Verfahrens wegen Vorlageverfahren „Reprobel″ vor dem EuGH
Aufgrund eines parallel beim EuGH anhängigen Vorlageverfahrens, das die Ausschüttungspraxis der belgischen Verwertungsgesellschaft Reprobel an die Verleger betraf (EuGH, Az. C-572/13 – Hewlett-Packard / Reprobel), setzte der BGH das Verfahren zwischenzeitlich aus.
Der EuGH entschied im November 2015, dass die belgische Rechtslage, die eine hälftige Verteilung der Einnahmen der Verwertungsgesellschaft zwischen Verlegern und Urhebern per Gesetz vorsieht, mit EU-Recht unvereinbar sei.
Der EuGH führte aus, dass nach dem einschlägigen Art. 5 Abs. 2 b) InfoSoc-Richtlinie (RL 2001/29/EG) nur dem Urheber (und nicht dem Verleger) ein gerechter Ausgleich für die aufgrund der Schrankenbestimmungen zulässigen Privatkopien zustehe. Dieser gerechte Ausgleich müsse „unbedingt″, also ohne Abzug, bei dem Urheber ankommen und dürfe nicht durch eine anteilige Beteiligung der Verlage geschmälert werden.
BGH: Ausschüttung muss von der Rechteeinbringung abhängig gemacht werden
Der BGH nahm nach dieser Entscheidung das Verfahren Vogel / VG Wort wieder auf und hat nun zugunsten des Klägers entschieden. Er begründet seine Entscheidung damit, dass den Verlegern – anders als den Autoren – keine eigenen Rechte, insbesondere kein eigenes Leistungsschutzrecht zustehe.
Verleger könnten daher nur von den Urhebern abgeleitete Rechte geltend machen. Die gesetzlichen Vergütungsansprüche stünden aber originär nur den Autoren zu. Die aufgrund der gesetzlichen Ansprüche bei der VG Wort erzielten Einnahmen dürften nicht ohne weitere Prüfung, ob die Verleger überhaupt von den Autoren abgeleitete Rechte wirksam inne hätten, pauschal mit einem hälftigen Anteil an die Verlage ausbezahlt werden.
Möglichkeit der Abtretung des Vergütungsanspruchs bisher nicht geklärt
Ob eine ausdrückliche Abtretung des gesetzlichen Vergütungsanspruchs der Autoren an die Verlage nach dem BGH-Urteil und insbesondere im Licht der „Reprobel″-Entscheidung des EuGH (s.o.) in Zukunft zulässig sein wird, ist bislang unklar. Viele Verlagsverträge sehen eine solche Abtretung derzeit noch im Hinblick auf § 63a S. 2 UrhG vor.
Ebenso ist unklar, ob eine geringere als die hälftige Beteiligung der Verlage als rechtmäßig angesehen werden könnte. Jedenfalls in der Pressemitteilung des BGH ist die Entscheidung interessanterweise überhaupt nicht erwähnt worden.
Das ganze Ausmaß der rechtlichen Auswirkungen wird erst absehbar sein, wenn die Urteilsgründe der BGH-Entscheidung veröffentlicht sind. Dies ist bislang aber noch nicht der Fall.
Verlage müssen mit Rückforderungen rechnen
Bereits jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass die Entscheidung des BGH für die Verlage eine „bittere Pille″ ist. Sie müssen nun für die bereits ausgezahlten Einnahmen mit teils hohen Rückforderungen rechnen. In Zukunft entgeht ihnen ein wichtiger Anteil an den gewohnten Einnahmen. Gerade für kleine und mittlere Verlage kann dies existenzbedrohend sein.
Der als Streithelferin beteiligte C.H. Beck Verlag hatte in dem BGH-Verfahren u.a. argumentiert, dass es erst der verlegerischen Leistung zu verdanken sei, dass Autoren überhaupt Einnahmen aus der Verwertung ihrer Werke erzielen könnten.
Obschon alle Beteiligten diese Auffassung zu teilen schienen, hat der BGH diesem Argument eine Absage erteilt, da es allein auf die Rechtslage ankomme.
Es ist allein Sache des Gesetzgebers, ob und inwieweit die verlegerische Leistung Schutz genießen soll,
so der Vorsitzende Richter Büscher in der Urteilsverkündung. Gleichzeitig gab Büscher laut Presseberichten in der Urteilsverkündung zu bedenken,
ob sich die Urheber einen Gefallen tun, wenn sie sich auf diese Weise von den Verlagen trennen.
Handlungsbedarf für den Justizminister
Jetzt muss sich zeigen, ob eine politische Lösung in Sicht ist. Justizminister Heiko Maas, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und EU-Kommissar Günther Oettinger haben bereits im Vorfeld der Entscheidung Handlungsbereitschaft zugunsten der Verlage signalisiert.
Möglicherweise wird eine Beteiligung der Verlage also durch eine Änderung der Gesetzeslage auf EU-Ebene wieder möglich werden. Bis dahin bleibt die Lage jedoch höchst unsicher.
Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie in unserem Blog auf dem Laufenden.