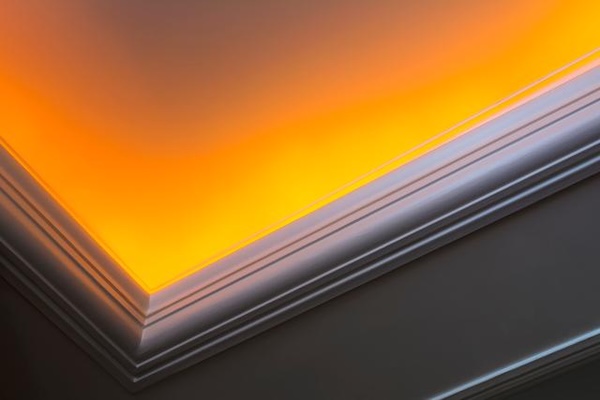Der BGH bestätigt seine bisherige Rechtsprechung zum Beginn der Verjährung bei Submissionsabsprachen und legt diesen Zeitpunkt deutlich später an als der EuGH.
In seinem inzwischen veröffentlichten Beschluss vom 17. September 2024 (KRB 101/23) setzt sich der BGH – einmal mehr – mit der Frage nach dem Beginn der Verjährungsfrist bei kartellrechtlichen Absprachen bei Ausschreibungen, sogenannten Submissionsabsprachen, auseinander. Die Frage erfuhr neue Aktualität, nachdem das OLG Düsseldorf (Urteil v. 11. November 2022 – 2 Kart 2/20 (OWi), gestützt auf die neue Rechtsprechung des EuGH (Urteil v. 14. Januar 2021 – C-450/19 – Eltel), von der bisherigen Linie des BGH abwich, und den relevanten Zeitpunkt für den Verjährungsbeginn wesentlich früher festlegte.
Der BGH hat klargestellt, dass er – auch vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung – keinen Anlass dazu sieht, von seiner bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. Es bleibt dabei, dass für den Verjährungsbeginn der Zeitpunkt der Stellung Schlussrechnung entscheidend ist. Dies bedeutet für Beteiligte an Submissionsabsprachen, dass die Verfolgungsgefahr auch noch lange nach Abschluss der „Tat“ bestehen bleibt.
Hintergrund: Submissionsabsprachen
Submissionsabsprachen sind Kartellabsprachen zwischen mehreren Unternehmen im Rahmen von öffentlichen oder vergleichbar organisierten privaten Ausschreibungen und verstoßen gegen Art. 101 AEUV/§ 1 GWB. Sie sind einerseits kartellrechtswidrig (§ 81 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 GWB) und andererseits auch strafbar (§ 298 StGB).
Verjährung von Submissionsabsprachen
Sowohl das Kartellrecht als auch das Strafrecht sehen für Submissionsabsprachen eine 5-jährige Verjährungsfrist vor (§ 81g Abs. 1 S. 2 GWB bzw. § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB). Sie beginnt, wenn die Tat beendet ist. Die Tatbeendigung knüpft nach dem Wortlaut sowohl der straf- als auch der kartellordnungswidrigkeitenrechtlichen Vorschriften (§ 31 Abs. 3 OWiG, § 78a StGB) an den Eintritt des letzten tatbestandlichen Erfolgs an, sofern die Handlung bzw. Tat nicht erst danach beendet ist. Nach der bisherigen ständigen Rechtsprechung des BGH konnte eine solche Tatbeendigung jedenfalls nicht vor Stellung der Schlussrechnung eintreten (BGH, Urteil v. 17. September 2024 – KRB 101/23), weil bis zu diesem Zeitpunkt das materielle Unrecht der Tat noch weiter vertieft wird beziehungsweise das sanktionsbewehrte Unrecht der Submissionsabsprache weiter andauert.
EuGH: Maßgeblich für Verjährungsbeginn ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses zwischen dem letztlich erfolgreichen Bieter und dem Auftraggeber
Anders beurteilte dies jedoch der EuGH und in der Konsequenz auch das OLG Düsseldorf in der Vorinstanz. Der EuGH stellte für den Verjährungsbeginn (nach Art. 25 Abs. 2 VO 1/2003) maßgeblich auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses zwischen dem letztlich erfolgreichen Bieter und dem Auftraggeber ab. Danach entspricht der Zeitraum der Zuwiderhandlung – und damit der Tat – eben diesem Zeitraum bis zur Unterzeichnung des Vertrags (EuGH, Urteil v. 14. Januar 2021, C-450/19 – Eltel). Auf dieser Grundlage wies sodann auch das OLG Düsseldorf einen Teil der Vorwürfe wegen inzwischen eingetretener Verjährung ab.
BGH: Verjährungsbeginn von Submissionsabsprachen nicht vor der Stellung der Schlussrechnung
Dieser Lesart der EU-rechtlichen Vorgaben trat der BGH in seinem jüngsten Urteil entgegen. Auch vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung bleibt es – so der BGH – dabei, dass die Verjährung von Submissionsabsprachen nicht vor der Stellung der Schlussrechnung zu laufen beginnen kann.
Dass der BGH auf einen anderen, späteren Zeitpunkt abstellt als der EuGH, stellt nach Auffassung des BGH lediglich einen vermeintlichen Widerspruch dar. Dies beruht auf den unterschiedlichen Tatbegriffen, die der EU-rechtlichen Verjährungsvorschrift des Art. 25 Abs. 2 VO 1/2003 einerseits und den nationalen Verjährungsvorschriften der § 31 Abs. 3 OWIG und § 78a StGB andererseits zugrunde liegen: So argumentiert der BGH, dass die Ausführungen des EuGH zum Verjährungsbeginn deshalb nicht auf das nationale Verjährungsrecht übertragbar sind, weil Art. 25 Abs. 2 VO 1/2003 ein anderer – rein tatbestandsbezogener – Tatbegriff zugrunde liegt. Im Gegensatz dazu betreffen die deutschen Vorschriften der § 31 Abs. 3 OWiG und § 78a StGB einen rein verjährungsrechtlichen Tatbegriff, der insbesondere von dem materiell-rechtlichen und dem prozessualen Tatbegriff zu unterscheiden ist.
Auf eben diesen verjährungsrechtlichen Tatbegriff kommt es nach Auffassung des BGH für die Ahndung von Kartellordnungswidrigkeiten durch die Wettbewerbs- und Verfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten an. Da das nationale Verfahrensrecht, worunter auch die Verfolgungsverjährung fällt, nicht harmonisiert ist, folgt auch keine Sperrwirkung aus Art. 25 Abs. 2 VO 1/2003. Die nationalen Verfahrensregelungen dürfen lediglich nicht dazu führen, dass die Durchsetzung des Unionsrechts übermäßig erschwert oder unmöglich gemacht wird (Effektivitätsgrundsatz) und auch der Äquivalenzgrundsatz gewahrt ist. Für die Verjährungsregelungen nach deutschem Recht bereitet dies keine Probleme. Der BGH sieht folglich auch keinen Anlass, dem EuGH die Frage der Vereinbarkeit der deutschen Regelungen zur Verfolgungsverjährung mit dem Unionsrecht vorzulegen.
BGH stellt sicher, dass verbotene Submissionsabsprachen noch viele Jahre nach der tatsächlichen Vornahme der Absprache verfolgt werden können
Für die Praxis bedeutet das Urteil des BGH, dass ein unter Umständen mit der EuGH-Rechtsprechung im Jahr 2021 eingetretenes Aufatmen von Beteiligten an vergangenen Submissionsabsprache verfrüht war. Der BGH begründet umfangreich, weshalb das EuGH-Urteil im nationalen Kontext keinen Anlass zur abweichenden Beurteilung des Verjährungsbeginns gibt, und stellt damit sicher, dass verbotene Submissionsabsprachen noch viele Jahre nach der tatsächlichen Vornahme der Absprache verfolgt werden können.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Verjährung nicht nur für den letztlich erfolgreichen Bieter mit der Erstellung der Schlussrechnung zu laufen beginnt, sondern aufgrund der Akzessorietät zur Anknüpfungstat (§ 30 Abs. 4 S. 3 OWiG) für alle an der Absprache beteiligten Unternehmen, insbesondere auch dann, wenn auf Grundlage der Absprache von der Abgabe eines eigenen Angebots abgesehen wurde.
Beruht das Submissionskartell zudem auf einer Grundabsprache zwischen den beteiligten Unternehmen, also dem Fall, dass nicht nur ein einzelnes Projekt abgesprochen wurde, sondern – auf Basis eines Gesamtplans – regelmäßig anstehende Projekt abgesprochen werden sollten, betrachtet der BGH diese als eine Bewertungseinheit. Verjährungsrechtlich beginnt dann für alle von dieser Bewertungseinheit erfassten Projekte die Verjährung erst mit Abschluss der gesamten Tat, also dem Zeitpunkt, zu dem das letzte, noch von der Grundabsprache erfasste, Projekt abgerechnet wurde.
Risiko für Kartellbußgelder droht für weit in der Vergangenheit liegende „Taten“
Der BGH lässt sich von der neueren Rechtsprechung des EuGH zum Verjährungsbeginn nicht ablenken. Er bleibt dabei, dass der früheste Zeitpunkt für den Beginn der Verjährungsfrist das Stellen der Schlussrechnung ist. Für Unternehmen bedeutet dies, dass auch viele Jahre nach „der Tat“ kartellrechtliche Bußgelder und im worst case strafrechtliche Sanktionen drohen können.