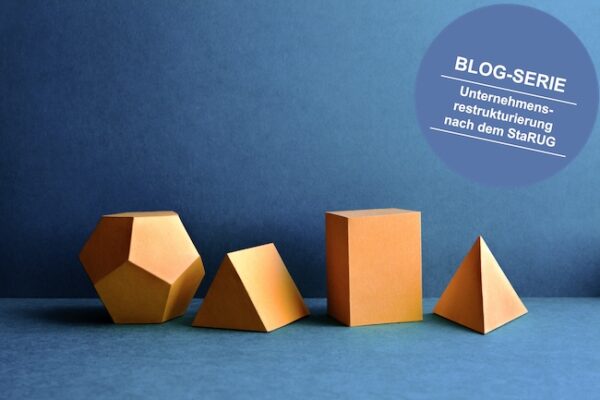Die Restrukturierung nach dem StaRUG kann unter den richtigen Voraussetzungen für Unternehmen eine sinnvolle Alternative zur außergerichtlichen Sanierung bzw. zum Insolvenzverfahren sein.
Das Ziel des seit dem 1. Januar 2021 geltenden „Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetzes“, kurz: StaRUG, besteht darin, Unternehmen frühzeitig im Rahmen eines sog. präventiven Restrukturierungsrahmens zu restrukturieren, bevor die Insolvenz eintritt. Der durch das StaRUG eingeführte präventive Restrukturierungsrahmen soll die Lücke zwischen der einvernehmlichen Restrukturierung des Schuldners vor Eintritt der Insolvenz (außergerichtliche Sanierung) und der Restrukturierung im Rahmen eines formellen Insolvenzverfahrens gemäß der EU-Restrukturierungsrichtlinie (EU 2019/1023) schließen.
Eine Restrukturierung nach dem StaRUG kann für Unternehmen eine sinnvolle Alternative zur außergerichtlichen Sanierung aber auch zum Insolvenzverfahren darstellen. Einerseits bietet es mehr Möglichkeiten als die außergerichtliche Sanierung und andererseits ermöglicht es einen finanziellen Neustart, ohne dass ein Insolvenzverfahren durchlaufen werden muss.
Das StaRUG – Teilkollektiver Charakter
Der Restrukturierungsplan nach dem StaRUG orientiert sich am Insolvenzplan gemäß der Insolvenzordnung, kann jedoch im Gegensatz zu diesem auch nur bestimmte Gruppen von Gläubigern betreffen. Es handelt sich somit nicht zwangsläufig um ein Kollektivverfahren; der Plan kann gezielt nur bestimmte Gruppen nach „sachgerechten Kriterien“ (§ 8 StaRUG) einbeziehen. Zum Beispiel kann der Schuldner das StaRUG auf seine Finanzgläubiger beschränken und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung unberührt lassen. Das StaRUG steht dem schuldnerischen Unternehmen zur Verfügung, sobald und solange lediglich eine drohende Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 18 InsO vorliegt. Der Schuldner kann dann aus einem modularen „Baukastensystem“ diejenigen Werkzeuge wählen, die er in seiner spezifischen Restrukturierungssituation benötigt. Es folgt dem Gedanken, dass der Schuldner als Planarchitekt entscheiden kann, welche Gläubiger in den Plan einbezogen werden sollen, und welche nicht. Gleichwohl ist eine Einbeziehung aller Gläubiger möglich.
Eine Ausnahme macht das StaRUG bei Arbeitnehmern. Forderungen von Arbeitnehmern, einschließlich der Rechte aus Zusagen auf betriebliche Altersversorgung, können nicht in den Restrukturierungsplan einbezogen werden.
Durch den Restrukturierungsplan kann auch in die Rechte der Anteilsinhaber der schuldnerischen Gesellschaft eingegriffen werden. Ein Beispiel hierfür ist der Plan bei der ersten großen Restrukturierung nach dem StaRUG, der Restrukturierung des Automobilzulieferers Leoni. Dieser Plan sah vor, das Grundkapital der Leoni AG auf null Euro herabzusetzen, verbunden mit einem Bezugsrechtsausschluss, was zur Ausscheidung der bisherigen Aktionäre führte.
Der besondere Vorteil des StaRUG besteht darin, dass die Restrukturierung ähnlich wie bei dem im Vereinigten Königreich bereits etablierten „scheme of arrangement“ außerhalb eines Insolvenzverfahrens erreicht werden kann, ohne dass einzelne Gläubiger, sog. „Akkordstörer“, dies verhindern können, wie es bei der außergerichtlichen Sanierung häufig der Fall ist.
Mögliche Restrukturierungsmaßnahmen innerhalb eines Restrukturierungsplans und gestaltbare Rechtsverhältnisse
Das StaRUG erlaubt eine Reihe von Restrukturierungsmaßnahmen, die – wie beimInsolvenzplan auch – grundsätzlich frei gestaltet werden können. Der Restrukturierungsplan kann daher sowohl eine finanzielle Umstrukturierung (z.B. Umschuldung, Schuldnerlasse, Stundungen, Schuldumwandlungen etc.) als auch eine gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung (z.B. Veräußerung einzelner Assets oder ganzer Betriebsteile, Umwandlungsmaßnahmen, Veräußerung des schuldnerischen Betriebs im Ganzen) vorsehen.
Das StaRUG nennt bestimmte Rechtsverhältnisse, die sich besonders für solche Gestaltungen eignen. Dazu gehören:
- Verbindlichkeiten des Schuldners (z.B. durch (teilweisen) Verzicht der Gläubiger),
- Sicherheiten, die der Schuldner gegeben hat;
- Sicherheiten, die mit dem Schuldner verbundene Unternehmen gegeben haben (z.B. durch Freigabe der Sicherheiten gegen angemessene Entschädigung);
- einzelne Vertragsklauseln in Verträgen zwischen dem Schuldner und mehreren Gläubigern (insbesondere Kreditverträge mit mehreren Kreditgebern, z.B. durch Änderung von Fälligkeiten, Bedingungen oder Kündigungsgründen in einem solchen Vertrag);
- Vereinbarungen zwischen den Gläubigern, an denen der Schuldner selbst – wie bei Vereinbarungen zwischen Kreditgebern – gar nicht beteiligt sein muss (z.B. durch Gestaltung dieser Verträge wie eine Änderung der erforderlichen Zustimmungsschwellen in Kreditverträgen oder Anpassung von Vereinbarungen zwischen Kreditgebern);
- Rechte an dem Schuldner, d.h. Rechte der Gesellschafter (z.B. durch Umwandlung von Schulden in Anteile -sog. Debt-to-Equity-Swap oder durch Übertragung von Anteilen an Dritte).
Von der Einbeziehung in eine Restrukturierung nach dem StaRUG ausgeschlossen sind die folgenden Forderungen:
- Forderungen von Arbeitnehmern aus ihrem Arbeitsverhältnis;
- Forderungen aus vorsätzlichen unerlaubten Handlungen;
- Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungs- und Zwangsgelder sowie vergleichbare Strafzahlungen.
Anders als im Insolvenzverfahren gibt es im Rahmen des StaRUG keine Beendigungs- oder Kündigungsmöglichkeit von schwebenden Verträgen. Eine diesbezügliche Regelung wurde nach heftiger Kritik des Gesetzesentwurfs seitens der Literatur gestrichen. Zusammen mit der fehlenden Einbeziehung der Arbeitnehmer in das StaRUG (also keine Gestaltung von Pensionsverbindlichkeiten und keine Kündigungserleichterungen) eignet sich das StaRUG damit vor allem für finanzielle Restrukturierungen, bei der sich Unternehmen von ihrer Schuldenlast befreien wollen. Diese erleichtern die Refinanzierung von operativ ertragreichen Unternehmen.
Aufbau und Inhalt des Restrukturierungsplans
In seinem Aufbau gleicht der Restrukturierungsplan dem Insolvenzplan. Er besteht aus einem darstellenden und einem gestaltenden Teil.
Der darstellende Teil soll das Vermögen des Schuldners bewerten und die Ursachen für die Krise darstellen. Es soll beschrieben werden, wie sich der Plan auf die Lage des Schuldners auswirkt. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen ist aufzuzeigen, wie sich die Situation des Schuldners und der Gläubiger ohne den Plan gestalten würde. Auch Informationen sowohl über die betroffenen Gläubiger als auch über die nicht betroffenen Gläubiger sollen im Plan enthalten sein. So ist z.B. zu erläutern, warum bestimmte Gläubiger in den Plan einbezogen werden und andere nicht. Ebenso soll die vorgesehene Einteilung der einzelnen betroffenen Gläubiger in Gruppen nachvollziehbar gemacht werden.
Im gestaltenden Teil werden die Maßnahmen dargelegt, mit welchen der Schuldner saniert werden soll. Dazu müssen Angaben erfolgen, wie sich die Rechtsstellung der Planbetroffenen durch den Plan ändert. Auf Grundlage des darstellenden und des gestaltenden Teils sollen die Planbetroffenen später eine Entscheidung in Form einer Abstimmung über den Plan treffen.
Einteilung der betroffenen Gläubiger in Gruppen
Damit die Planbetroffenen sachgerecht über den vom Schuldner vorgeschlagenen Plan entscheiden können, gibt das StaRUG die Einteilung in Gruppen vor. Die Gruppen sollen anhand ihrer vergleichbaren Rechte oder gleichgerichteten Interessen zusammengefasst werden. Dadurch wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Gläubiger in unterschiedlicher Weise von einer Krise des Schuldners betroffen sein können, etwa, wenn ein Gläubiger über umfangreiche Sicherungen verfügt. Zudem erlaubt das Gesetz, dass jeder Gruppe unterschiedliche Rechte angeboten werden können. Der Planarchitekt kann durch eine gezielte Gruppeneinteilung also die Annahme des Plans beeinflussen.
Beispiele für einzelne Gruppen können sein:
- Inhaber von Sicherungsrechten;
- Inhaber von Forderungen aus Finanzverbindlichkeiten;
- Inhaber von Forderungen, die im Insolvenzfall nicht nachrangige Insolvenzforderungen dar-stellen würden;
- Inhaber von Forderungen aus Gesellschafterdarlehen und Forderungen, die dem insolvenz-rechtlichen Nachrang unterliegen;
- Inhaber von Geschäftsanteilen oder Mitgliedschaftsrechten und
Inhaber von Drittsicherheiten.
Nachhaltige Beseitigung der drohenden Zahlungsunfähigkeit
Das Gesetz verzichtet grundlegend auf die Einführung eines Bestandsfähigkeitsnachweises. Dennoch kann ein Schuldner im Anwendungsbereich des Gesetzes nicht zu jeder Zeit auf den Restrukturierungsplan und dessen Instrumente zurückgreifen. Das dem StaRUG und dem Restrukturierungsplan zugrundeliegende Ziel ist die nachhaltige Beseitigung der drohenden Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in den nächsten 24 Monaten eine nicht gedeckte Liquiditätslücke aufweist.
Soll der Plan – gegebenenfalls gegen den Willen der beteiligten ablehnenden Minderheit – gerichtlich bestätigt werden, so prüft das Gericht die drohende Zahlungsunfähigkeit. Selbstverständlich kann der Schuldner auch abseits der drohenden Zahlungsunfähigkeit mit seinen Gläubigern verhandeln und einen Vergleich schließen. Es fehlt dann aber an der Möglichkeit, Planbetroffene gegen deren Willen zu binden.
Abstimmung über den Restrukturierungsplan
Der Restrukturierungsplan muss den betroffenen Gläubigern zur Abstimmung gestellt werden. Wichtig hierbei ist, dass nur die vom Plan betroffenen Gläubiger abstimmungsberechtigt sind. Betroffen sind die Gläubiger, dessen Rechtsstellung durch den Plan verändert wird. Die Gläubiger, deren Rechte durch den Restrukturierungsplan nicht berührt werden, haben kein Recht, über den Plan abzustimmen. Zur Annahme des Restrukturierungsplans ist grundsätzlich eine Mehrheit von 75% der in jeder Gruppe vorhanden Stimmrechte erforderlich, also nicht nur derjenigen, die an der Abstimmung tatsächlich teilnehmen. Der Restrukturierungsplan ist damit vergleichsweise restriktiv. Die Richtlinie erfordert als Mindestgrenze nur eine einfache Summenmehrheit. Auch der Insolvenzplan erfordert nur eine einfach Kopf- sowie Summenmehrheit. Im internationalen Vergleich orientiert sich das StaRUG damit eher am englischen Scheme of Arrangement, welches ebenfalls ein Quorum von 75 % (aber zusätzlich eine einfache Kopfmehrheit) vorsieht. Die Niederlande verlangen im „Dutch Scheme“ hingegen nur eine Zweidrittelsummenmehrheit.
Die Stimmrechte richten sich nach den folgenden Kriterien:
- Gesicherte Gläubiger: Wert der Sicherheit
- Ungesicherte Gläubiger: Betrag der Forderung
- Anteilsinhaber: Nomineller Anteil am gezeichneten Kapital oder Vermögen des Schuldners
Stimmt jede Gruppe mit der erforderlichen Mehrheit für den Restrukturierungsplan, gilt dieser als angenommen und entfaltet mit dem Bestätigungsbeschluss des Gerichts Wirkung gegenüber den Planbetroffenen.
Wird die erforderliche Mehrheit in einer Gruppe nicht erreicht wird, kann unter bestimmten Bedingungen ihre Zustimmung durch eine sog. gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung (sog. Cross-Class Cram-Down) ersetzt werden. In diesem Fall gilt die Zustimmung einer spezifischen Gruppe als erteilt. Die wichtigsten Voraussetzungen für eine solche Ersetzung der Zustimmung sind, dass
- die ablehnende Gruppe durch den Plan nicht schlechter gestellt wird als im nächstbesten Alternativszenario ohne Plan, wobei dieser Wert grundsätzlich nach Fortführungswerten zu berechnen ist;
- der Plan von der Mehrheit der abstimmenden Gruppen angenommen wurde und
- sichergestellt ist, dass die Gläubiger einer widersprechenden Gruppe, deren Zustimmung durch die Planbestätigung ersetzt wird, vollständig befriedigt werden, bevor eine im Rang unter ihnen stehende Gruppe einen wirtschaftlichen Wert erhält (sogenannte absolute Vorrangregel). Von dieser Grundsatzregel macht das StaRUG jedoch auch Ausnahmen.
Sieht der Restrukturierungsplan nur zwei Gruppen vor, ist die Zustimmung einer Gruppe ausreichend, um die Gläubiger in der ablehnenden Gruppe zu überstimmen. Dabei darf jedoch die Zustimmung nicht ausschließlich durch Gesellschafter und Nachranggläubiger erfolgen.
Bindungswirkung des Restrukturierungsplans
Ein bestätigter Plan ist nach den gesetzlichen Vorgaben für alle beteiligten Parteien bindend. Eine Wirkungserstreckung auf nicht beteiligte Parteien ist dagegen nicht möglich. Als Rechtsbehelf sieht das StaRUG die sofortige Beschwerde vor. Diese hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. Damit soll verhindert werden, dass opponierende Gläubiger oder Anteilseigner die Wirkung des Restrukturierungsplans durch Rechtsbehelfe, die Suspensiveffekte haben, auf unbestimmte Zeit blockieren können.
Sinnvolle Alternative zur außergerichtlichen Sanierung und zum Insolvenzverfahren
Die Restrukturierung durch das StaRUG eignet sich insbesondere für die finanzielle Restrukturierung eines Unternehmens. Beispielsweise können ungünstige Verträge auch gegen den Willen des Vertragspartners kurzfristig beendet werden. Wenn das Unternehmen jedoch vor operativen oder strategischen Herausforderungen steht, bietet das Insolvenzverfahren (eventuell in Eigenverwaltung und möglicherweise im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens) oft bessere Möglichkeiten.
Die bisherigen praktischen Erfahrungen mit dem StaRUG sind allerdings noch sehr begrenzt. Daher erfordert die Entscheidung für eine Restrukturierung nach dem StaRUG stets sorgfältige Überlegungen. Dennoch ist in letzter Zeit zu beobachten, dass große Unternehmen wie Leoni oder Gerry Weber erfolgreich eine Restrukturierung nach dem StaRUG durchgeführt haben.
Der Beitrag ist Teil unserer Blogreihe zur Unternehmensrestrukturierung nach dem StaRUG. Es erschienen bereits zahlreiche Beiträge zur europäischen Restrukturierungsrichtlinie, u.a. ein Beitrag zu den Moratorien und zu den Restrukturierungsplänen. Anschließend haben wir uns mit den Pflichten der Unternehmensleitung, dem Schutz von Finanzierungen und Finanzierungsgebern sowie den Restrukturierungsbeauftragten und Verwaltern befasst. Weiter sind wir auf die Entschuldung insolventer Unternehmer, arbeitsrechtliche Aspekte der Restrukturierungs-Richtlinie, das Dutch Scheme als Vorbild für den Restrukturierungsrahmen sowie eine Sanierung außerhalb der Insolvenz eingegangen.